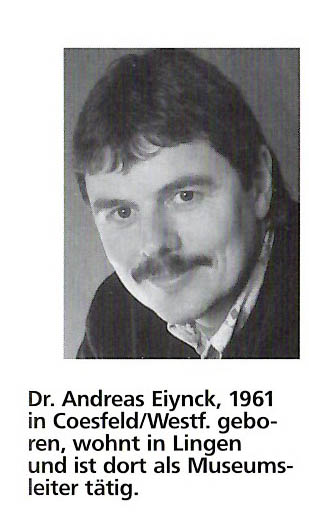Die Sputnik-Generation
Daß der Niedergang der niederdeutschen Sprache mit einem Ereignis im Weltall zusammenhängen könnte, mag auf den ersten Blick unwahrscheinlich erscheinen. Als aber im Herbst 1957 die Sowjetunion die beiden Satelliten Sputnik I und II mit der Polarhündin Leika in den Weltraum katapultierte, wurde dieses Ereignis zu einem Wesentlichen Auslöser der bildungs- und gesellschaftspolitischen Diskussionen und Reformen der 60er Jahre. Es entstand die sogenannte „Sputnik-Generation”, die mit Kurzschuljahren in das Bildungssystem eingeführt, mit der Abschaffung der Volksschule und der Zwergschulen weiterbetreut und schließlich, nun schon in den 70er Jahren, mit der Einführung der reformierten Oberstufe beglückt wurde. Mengenlehre, englische Sprache und nicht zuletzt die Popmusik haben das Denken (und Handeln?) dieser Generation geprägt, zu der zu zählen auch ich mich glücklich schätzen darf.
Denn eigentlich, das muß man offen bekennen, fehlte es uns, den Kindern und Jugendlichen der 60er und 70er Jahre, an nichts. Alles konnten wir werden, haben, erreichen, nur eines war verpönt – die plattdeutsche Sprache und die damit verbundene traditionelle Lebenswelt auf dem Lande, die als ein entscheidender Hemmschuh für „fortschrittliche Entwicklung” von Bildung und Gesellschaft und vor allem bei der korrekten Erlernung der schwierigen hochdeutschen Sprache angesehen wurde.
Auch in unserem münsterländischen Landstädtchen vermieden es unsere Eltern ganz bewußt, ihre überlieferte Mundart an uns weiterzugeben. Aus uns sollte schließlich etwas werden: Lehrer, Beamter oder gar Ingenieur. Plattdeutsch konnte bei solchen Bildungszielen nur hinderlich sein.
So plagten wir uns mit „mir” und „mich” oder „wem” und „wen”, wobei den Möglichkeiten zur grammatikalischen Hilfestellung durch unsere Erzieher gelegentlich enge Grenzen gesetzt waren. Nur wer Glück hatte, konnte bei Großeltern, Verwandten oder Nachbarn auch plattdeutsche Grundkenntnisse aufschnappen – und das in der Heimat von Augustin Wibbelt und Karl Wagenfeld, Anton Aulke und Natz Thier.
Aber – ehrlich gesagt – so richtig vermißt haben wir als Kinder und Jugendliche das Plattdeutsche damals nicht. Ganz sang- und klanglos verschwand innerhalb einer Generation das Plattdeutsche aus vielen Familien und aus der Öffentlichkeit.
Irgendwann in den 70er Jahren kam es dann plötzlich wieder – zunächst gezähmt in „plattdeutschen Kursen” und Lesewettbewerben. Als zartes Pflänzchen sollte hier wieder gedeihen, was man zwanzig Jahre vorher noch hatte ausmerzen wollen. Ob diesen pädagogischen Ansätzen zur Erhaltung der plattdeutschen Sprache ein dauerhafter Erfolg beschieden sein wird, mag die Zukunft zeigen.
Auch in einem ganz anderen Bereich tauchte das Plattdeutsche in den 70er Jahren wieder auf: In den beliebten plattdeutschen Theaterkomödien und den sogenannten Sketchen. In ihnen wurde zumeist das traditionelle Leben auf dem Lande auf die Schippe genommen, und durch die derbe Art der Aufführungen wurden auch die Lachmuskeln der (fast) Sprachunkundigen arg strapaziert.
Später dann schwappte das Plattdeutsche im Zuge der Nostalgiewelle noch einmal mit breitem Wellenschlag über das öffentliche Parkett. Überall, besonders auf dem Lande, hörte man nun bei Festreden, Eröffnungen, Jubiläen wieder plattdeutsche Exkurse, zumeist verbunden mit einem flammenden Bekenntnis zur plattdeutschen Kultur und Wesensart, die es auch jungen Menschen zu vermitteln gelte. Peinlich wirkt dies immer dann, wenn es von Rednern vorgetragen wird, die sich beim Plattdeutschen offenbar selber auf nicht ganz sicherem Parkett bewegen…
Und die Jüngeren, denen das Plattdeutsche wieder vermittelt werden soll? Den meisten von „uns Jüngeren”, jedenfalls denen aus der „Sputnik-Generation”, fehlen die dafür notwendigen Voraussetzungen. Das Plattdeutsche, die „Muttersprache” unserer Mütter, ist uns zur Fremdsprache geworden. Den meisten blieb sie ebenso fremd wie das „Vaterland” unserer Väter, das uns durch das „Europa der Zukunft” längst abgelöst schien.
Daß mich meine berufliche Zukunft später einmal sozusagen zum „Profi-Niedersachsen” machen würde, dessen Arbeitgeber die niederdeutsche Tradition einer ganzen Region geradezu verkörpert, habe ich mir damals noch nicht träumen lassen. Erst im Laufe der Berufsausbildung wuchs mein Interesse an der niederdeutschen Kultur, die ich bald eifrig studierte und über die ich auch promovierte. Eines lernte ich dabei nicht – Plattdeutsch.
Oft schon habe ich mich dann in den letzten Jahren, hier in der Provinz, gefragt: Kann man eigentlich im Emsland als Museumsleiter tätig sein, ohne die örtliche plattdeutsche Sprache aktiv zu beherrschen? (Und manche werden sich das vielleicht auch schon gefragt haben.) Eine endgültige Antwort darauf habe ich für mich bislang noch nicht gefunden – aber man ist ja noch lernfähig.