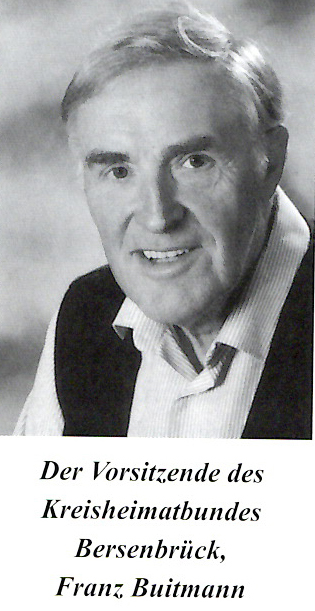von Rektor a.D. Franz Buitmann, Bersenbrück
„Zurück zu den Wurzeln“ – dieser Ausspruch ist in der gegenwärtigen Zeit ein gängiges Wort. Möchte man aber wirklich in eine Zeit zurück, die im Vergleich zu heute um ein Vielfaches schwieriger, härter, entbehrungsreicher und unsicherer war? Ich spreche von der Zeit in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges, von den Nachkriegsjahren und den Jahren des Wiederaufbaus Deutschlands in den fünfziger Jahren.
Diese Zeit habe ich, 1943 geboren, in einem Heuerhaus im Handruper Ortsteil Hestrup miterlebt. Mein Vater war wie so viele andere Männer Soldat der Wehrmacht geworden. Wie ich später von meiner Mutter erfuhr, in keinem Falle freiwillig. Viel lieber hätte er seine Arbeit als Stellmachermeister weiter geführt und wäre bei seiner Familie geblieben. So aber musste er in Russland an die Front gehen. Das letzte Lebenszeichen kam 1944 aus dem Raum Smolensk; seitdem galt er als „vermisst“. Bis heute habe ich keine Spur von ihm finden können, ich habe ihn also nicht bewusst kennen lernen dürfen.
Somit wuchs ich im Haus der Eltern meiner Mutter – eben in einem Heuerhaus – auf und wurde dadurch bedingt mit allen Arbeiten in der eigenen kleinen Landwirtschaft, aber auch auf dem großen Hof „unseres Bauern“, so sagten wir, vertraut. Da ich Einzelkind blieb, wurde ich von Anfang an wie selbstverständlich in den täglichen Lebensrhythmus einer Heuerlingsfamilie eingebunden.
Die anfallende Arbeit waren derart vielgestaltig, dass ich mehrere „Berufe“ gleichzeitig zu bewältigen hatte. Da galt es das Vieh zu versorgen, die Ländereien zu bestellen und später die Ernte einzufahren, Gartenarbeit zu verrichten, im Haushalt mitzuhelfen, Einkäufe zu tätigen, aufzuräumen, Ausbesserungen vorzunehmen, und vieles andere, angeleitet zunächst von meinen Großeltern und meiner Mutter. Aber zunehmend lernte ich selbstständig zu handeln und vor allem Verantwortung übernehmen – alles wichtige Erfahrungen für das spätere Leben. Was ich außerdem lernte, war mit Wenigem auszukommen. Die Heuer meiner Großeltern brachte gerade so viel ein, um „über die Runden zu kommen“.
Jeder Pfennig wurde zweimal umgedreht, bevor er ausgegeben wurde. Kleine Ersparnisse wurden trotzdem möglich, um für unvorhergesehene Ausgaben gewappnet zu sein. Es wurde kaum etwas „entsorgt“, so wie es heute üblich ist.
Speisereste wurden wieder verwertet, oder wenn nicht mehr genießbar, verfüttert. Der eigene Garten lieferte alles Notwendige, Fleisch stammte aus eigener Produktion.
Mit den nicht benötigten Hühnereiern wurden im Laden die Lebensmittel eingetauscht, die nicht selbst herzustellen waren. Nicht mehr brauchbare Haushaltsgegenstände wurden nicht weggeworfen, sondern auf den Boden gebracht, „man kann ja vielleicht noch mal Teile davon gebrauchen“. Dieses Aufbewahren galt auch für Geräte aus der Landwirtschaft. Bis heute fällt es mir schwer, mich von Gegenständen zu trennen, diese Art von Sparsamkeit hat sich bei mir tief eingegraben.
In meiner Erinnerung an das Leben in einem Heuerhaus ist mir besonders die Abhängigkeit, teilweise Hilflosigkeit, dem „Bauern“ gegenüber im Gedächtnis geblieben. Da hatte man für den nächsten Tag die Arbeit in der eigenen Landwirtschaft geplant, am späten Abend kam ein Kind des Bauern, um für den nächsten Tag einen Arbeitseinsatz auf dem Hof anzufordern. Da wurde nicht gefragt, ob man es einrichten könne, die eigene geplante Arbeit musste zurück gestellt werden. Als Entlohnung waren am Tag 50 Pfennige vereinbart worden, auch damals nicht gerade ein „Mindestlohn“. In einem eigenen Heft wurden die beim Bauern geleisteten Arbeitstage eingetragen. Die Gesamtzahl der Arbeitstage war mit dem Bauern vereinbart worden, konnte aber in besonderen Situationen geändert werden.
Unser Heuerhaus war teilweise mit Stroh gedeckt. Die Wände bestanden zum Teil aus Lehmgefachen. Nach und nach wurden die Lehmwände zwar durch Ziegelsteine ersetzt, aber ohne irgendeine Isolierung. Bei strengeren Wintern wachte ich morgens nicht selten auf, um an der Innenwand eine Eisschicht vorzufinden, die in der Nacht durch die Atmungsfeuchtigkeit entstanden war. Das Strohdach war an vielen Stellen undicht. Es wurde aus Kostengründen nur notdürftig mit eigener Hand ausgebessert. Ich entsinne mich, dass Ratten in das Stroh Löcher gefressen hatten. Nach einer längeren Trockenperiode schauten sie bei einsetzendem Regen aus den Löchern heraus, um zu trinken. Ich machte mir den Spaß, sie mit Erdklumpen oder Steinchen treffen und vertreiben zu wollen.
Die Toilette befand sich in einem Häuschen mit „Plumpsklo“ im Außenbereich des Hauses. Besonders im Winter und bei Nacht wurde es nicht gerade gern aufgesucht. Wasser schöpften wir zeitweilig aus einem Brunnen, später wurde es mit Hilfe einer Pumpe in der Waschküche gefördert. Nitratwerte waren ein Fremdwort.
Dabei wurde die anfallende Jauche von Mensch und Tier und ebenso das Material vom Misthaufen, auf dem alles Mögliche entsorgt wurde, in der Nähe des Brunnens in reichlicher Menge als Dünger ausgebracht. Das Abwasser floss – natürlich ungeklärt – in den nächsten Graben.
Auch wenn sicher der Heuermann in einer Abhängigkeit zum Bauern stand – letztendlich war es eine „Schicksalsgemeinschaft“, man war doch irgendwie aufeinander angewiesen. Ich muss sagen, unser Verhältnis zum Bauern war ein freundschaftliches. Wir fühlten uns nicht ausgenutzt. Feste wurden gemeinsam gefeiert, genauso wurde gemeinsam getrauert. Wenn meine Mutter im Winter dem Bauern beim Schlachten helfen musste, brachte sie abends immer ein Stück Fleisch als Dankeschön mit nach Hause. Das galt auch in Zeiten der Ernte bei Obst und Gemüse.
Ende der fünfziger Jahre näherte sich das Ende der Heuermannszeit. Zunehmend bekamen die Heuerleute die Möglichkeit, von ihrem Bauern das Haus mit einigen Hektar Land zu erwerben. So war es auch bei uns. An uns und zwei weitere Heuermannsfamilien verkaufte unser Bauer die Anwesen. Durch einen Neubau konnte die Wohnsituation bei uns wesentlich verbessert werden; die Zeit der Abhängigkeit war vorüber.
Ein bezeichnendes Erlebnis verdeutlicht die soziale Stellung eines Heuermanns in der Gesellschaft der damaligen Zeit. Am Ende der Grundschulzeit stand in der Volksschule bei Kindern, die das Zeug für eine weiterführende Schule hatten, die Frage eines Wechsels an.
Meine Mutter und meine Großeltern wären nie auf den Gedanken gekommen, mich auf ein Gymnasium zu schicken. „Wat segget wohl dei Naobers un Verwandten, een Hürmann-Junge kann dao nich hen!“ – das gehörte sich einfach nicht. Mein damaliger Klassenlehrer hatte alle Mühe, Mutter und Großeltern von einem derartigen Vorhaben zu überzeugen. Mit Tränen in den Augen aus Sorge um das drohende Gerede im Dorf stimmten sie schließlich zu.
Dass ich dann im Kloster Handrup mein Abitur machen konnte, in Vechta die Pädagogische Hochschule besuchte und 42 Jahre als Lehrer in Bersenbrück tätig sein konnte, davon 18 Jahre als Konrektor einer Orientierungsstufe und 15 Jahre als Rektor einer großen Grundschule – dieser Weg war mir sicher nicht im Handruper Heuerhaus in die Wiege gelegt worden. Mit Dankbarkeit und auch ein wenig Stolz blicke ich heute auf meinen Lebensweg zurück.