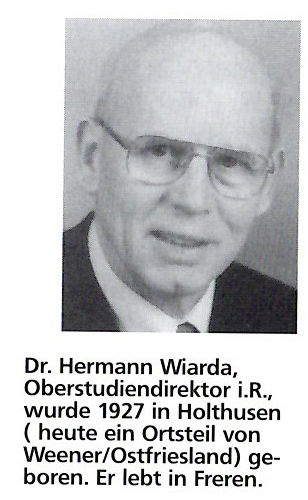„Har’n Se`n Törfpand…”
Wer wie ich aus einer ostfriesischen Familie stammt und dessen Vater noch in einer hochdeutschen, plattdeutschen und niederländischen Sprachumgebung aufwuchs, hat zu dem Plattdeutschen eine ganz besondere Beziehung, obwohl bei uns zu Hause die Umgangssprache zwischen Eltern und sechs Geschwistern Hochdeutsch war.
Das Plattdeutsche tröpfelte jedoch jeden Tag in unsere Ohren: „He ridd up`t Perd un` söcht daornao!”, „Wat se half weet, kann se ganz verteilen!”, „Kieneen is so klook äs man sülvs!” und „Loop nich mit Ian un alle Mann!” bemerkte mein vaier spaßig oder mahnend; las abends im Familienkreis plattdeutsche Geschichten von Fritz Reuter vor und versank, wenn alte Freunde oder Bekannte aus seiner Jugend- und Studienzeit kamen, regelrecht in dem ihm vertrauten ostfriesischen Platt.
Wir Kleinen standen dabei und hörten staunend zu. Als Kinder kamen wir infolge der Versetzung meines Vaters nach Lünne in eine Emsländer Platt sprechende Einwohnerschaft, die meinte, mit uns Pastorenkindern hochdeutsch reden zu müssen, dabei aber viele plattdeutsche Wortgebilde einfließen ließ, so daß wir zu Hause zurückfragten, was wohl gemeint gewesen sei. Weil ich mich in jeder freien Minute bei den Bauern in der Nachbarschaft aufhielt, lernte ich das Plattdeutsche im täglichen Umgang ganz von selbst und erwarb während meiner landwirtschaftlichen Lehre im ehemaligen Landkreis Lingen auch ein Gespür für die in dem Plattdeutschen sehr wohl vorhandenen Sprachebenen, die zahlreichen Lautmalereien und Sprachbilder, Sprichwörter und nicht zuletzt für den tieferen Sinn der zahlreichen emsländischen Dönkes.
Im Verlauf meiner langjährigen Tätigkeit als freier Mitarbeiter bei der hiesigen Zeitung kam es zu intensiven Berührungen mit dem plattdeutschen Theaterspiel, das ich bis heute mit viel Freude in der gleichen Sprache kommentiere. Meine Erfahrungen in dem aktiven Umgang mit dem Plattdeutschen sind mir heute zu einer glücklichen Erinnerung geworden. Mir ist immer wieder aufgefallen, daß das Plattdeutsche unter den in dieser Mundart Kundigen sofort Vertrautheit schafft; man erfreut sich nicht nur gleicher regionaler Herkunft, sondern fühlt sich auch zusammengehörig. Menschen einer Landschaft denken in ähnlichen Kategorien, wie sie durch das Zusammenleben von mehreren Generationen, den Rhythmus von Saat und Ernte, die Verknüpfung von Arbeit und Lebensunterhalt und auch durch Geburt und Tod bestimmt werden.
Ich erinnere zum Beispiel an die Pluralanrede gegenüber alten Menschen und oft auch gegenüber den ergrauten eigenen Eltern. Mir sind die Koseworte gegenüber kleinen Kindern ebenso in den Ohren wie die sehr differenziert angewendete sprachliche Begegnung mit Gleichgestellten, höher oder niedriger betrachteten Menschen. Der Begriff der Sprachsoziologie war noch nicht formuliert, aber dem Kenner des Plattdeutschen innerhalb der gewohnten Wortbedeutungen und verwendeten Lautierung vertraut. Jede Generation übernahm den Wortschatz von der vorhergehenden; das Plattdeutsche konnte sich, da es nicht in die Fesseln einer Schriftsprache eingebunden war, immer weiter entwickeln und viele Dialekte bilden.
Plattdeutsch bleibt im Menschen auch dann haften, wenn er, aus welchen Gründen auch immer, einer hochdeutschen Umgebung und einer zusätzlichen und verpflichtenden hochdeutschen Amtssprache ausgesetzt wird. Die eingeschlagenen Pfosten plattdeutschen Wortschatzes zur humorvollen Beschreibung besonderer Umstände, das Instrument einer wohl angeborenen Lautmalerei und das Wich-tigsein einer menschlichen Gesprächsatmosphäre treten immer wieder hervor und kennzeichnen sowohl die Menschen des emsländischen als auch des ostfriesischen Raumes. In Aurich war (und ist hoffentlich noch) an dem Regierungsgebäude auf einer unübersehbaren Tafel zu lesen. „Hier word Platt prot`t!”
Für mich als Leiter eines Studienseminars zur Ausbildung von Studienreferendaren für das Lehramt an berufsbildenden Schulen war die Verwendung des Plattdeutschen ein vielseitiges methodisches Instrument. Lehrer und Lehrerinnen, die platt sprechen, sind den emsländischen und ostfriesischen Schülern auch heute noch näher und vertrauter als ein „nur” hochdeutscher Pädagoge. Die Auszubildenden haben mehr Möglichkeiten, sich im Unterrichtsgespräch zu artikulieren und vor allem ihrer Meinung zu dem jeweiligen Stoff deutliche Konturen zu verleihen, die manchmal sogar zu einem vielschichtigen Statement werden.
Ein Schüler sagte am Ende einer Stunde, in der über die Abhängigkeit der Bevölkerung von dem Erdöl gesprochen wurde, seinem erstaunten Lehrer: „Har’n
Törfpand, har’n Se kiene Ölkrise; awer Se bünt ja nick von hier!” Als der junge Kollege das Argument einer drohenden Arbeitslosigkeit in das Gespräch einbrachte, lautete die Antwort: „Dann häbt wi Tied, alles önnlick naotokieken, uptorümen un alles in Schuß to brengen!” Dem plattdeutsch sprechenden Lehrer steht ein Vielfaches an Möglichkeiten der Impulsgebung zur Verfügung, weil er alle Lernenden mittels unterschiedlichen Sprachgebrauchs und damit reicherer Verwendung von Verben ansprechen kann und auch die erreicht, die als Auszubildende einem ausschließlich plattdeutsch sprechenden Meister oder Gesellen und vielfach auch Kunden gegenüber stehen.
Vergessen wir nicht: Das Emsland und besonders Ostfriesland sind mit Ausnahme der Städte, scharf formuliert, auch heute noch plattdeutsch geprägte Räume, die sich dem Hochdeutschen geöffnet haben. Man gehe einmal zu Volksfesten oder Familienfeiern auf dem Lande, um das zu erleben. An dieser Stelle sei ein Wort zu den plattdeutschen Lesewettbewerben erlaubt: Kein noch so guter Lesewettbewerb kann die wenn auch nur in homöopathischen Dosen verabreichten plattdeutschen Äußerungen eines methodisch geschickt agierenden Lehrers ersetzen; im Unterricht wird Plattdeutsch erlebt, im Lesewettbewerb viel zu oft ohne Verinnerlichung nachgeahmt.
In meinem heutigen Leben bereitet es mir jedes Mal Vergnügen, mit plattdeutsch sprechenden Menschen zusammenzukommen. Der Kontakt zu Nachbarn, Handwerkern und anderen läßt sich, wenn das Wort erlaubt ist, viel gemütlicher an, man fällt nicht mit der Tür ins Haus, erst kommt ein „Prötken över`t Weer”: „Wi mött sao nödig Regen hebben…!” Danach wird dann das gewünschte Anliegen vorgebracht. Plattdeutsch zu sprechen hat immer auch etwas mit „Zeit haben” zu tun. Vielleicht gehört das Prötken auch in den immerwährenden Rhythmus von Arbeit und Pause.
Die soziale Bedeutung des gemeinsamen Plattdeutsch ist seit dem letzten Krieg nicht mehr gegeben. Die erheblich gewachsene Bevölkerung bietet einen sprachlichen Flickenteppich, von dem man nicht weiß, wie er sich weiterhin gestalten wird, zumal Medien und Werbung als nicht willkommene Sprachlehrer einen immer größeren Einfluß erhalten. Die gegenwärtige kulturelle Bedeutung des Plattdeutschen sehe ich darin, daß es eine der wichtigsten Ausdrucksformen bietet, um altes emsländisches Brauchtum zu beschreiben, das von seiner damals verwendeten Sprache nicht zu trennen ist. Desgleichen bedarf es auch des überlieferten Plattdeutsch, um frühere menschliche Schicksale in dieser Landschaft zu beschreiben, die immer etwas mit Sprache zu tun hatten.