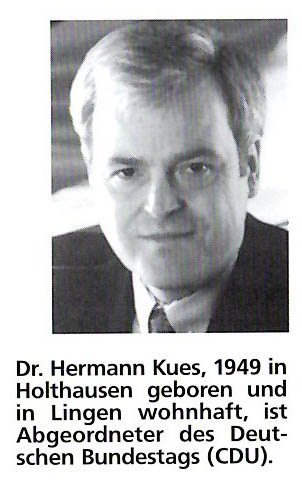Omas Kulturschock
Plattdeutsch ist meine Muttersprache. Ohne Plattdeutsch hätte ich mich in den 50er Jahren in dem damals circa 300-Einwohner-Dorf Holthausen bei Lingen gar nicht verständigen können. Es war keine Frage von „Identität” oder „kultureller Vielfalt”, nein, das war gewissermaßen auch schlicht eine Überlebensfrage.
Sehr gut in Erinnerung habe ich noch die Art und Weise, wie meine Großmutter väterlicherseits, die mit uns im Haushalt lebte, die Konfrontation mit dem Kulturschock „Hochdeutsch” verarbeitete, also die Konfrontation mit Menschen, die nur hochdeutsch sprachen, oder aus ihrer Sicht: Die als plattdeutsche Analphabeten nur Bahnhof verstehen. Wir gehörten damals zu den wenigen Haushalten mit einem öffentlichen Telefonanschluß. Wenn sie mit uns Kindern allein zu Haus war und sich gezwungen sah, das Telefon zu bedienen, pflegte sie nach dem Abnehmen des Hörers das noch nicht begonnene Gespräch mit dem Hinweis zu beenden: „Hier ist keiner zu Hause.” Gespräche meiner Oma mit einer Altersgenossin, die als Folge der Kriegswirren und der anschließenden Vertreibung mit uns im gleichen Hause wohnte und im Gegensatz zu ihr kein Wort Platt, sondern nur Hochdeutsch sprach, habe ich so in Erinnerung, als wenn ein Deutscher erstmalig versucht, mit einem Japaner in Kontakt zu treten.
Für mich selbst gehörte ausschließlich Plattdeutsch zu meiner Vorstellungswelt. Als ich eingeschult wurde in die zweiklassige Volksschule Holthausen, änderte sich dieses. Wir mußten aber, da sich vier Jahrgänge in einem Raum befanden, relativ wenig reden, und wir waren es als Kinder ohnehin gewohnt, den Mund zu halten. In den Pausen sowie ab mittags ging es plattdeutsch weiter. Fast parallel dazu lernte ich als Meßdiener – eigentlich wurde jeder Junge nach der Erstkommunion Meßdiener – die ersten Brocken Latein. Erfahrene Meßdiener wußten allerdings, daß bei Teilen des Stufengebets der laut gesprochene Anfang und das laut gesprochene Ende in Latein dem Priester als Antwort genügten.
Für die Aufnahmeprüfung zum Gymnasium wurde ich von meiner Lehrerin, der ich im Nachhinein so richtig dankbar dafür bin, im privaten Wohnzimmer „auf hochdeutsch” getrimmt. Es reichte für die Aufnahme. Auf dem Gymnasium selbst spielten wir allerdings als diejenigen, die vom Lande kamen, eine Sonderrolle. Das Leben außerhalb der Schule ging bis zur Oberstufe mehr oder weniger an uns vorbei. Wir fuhren mittags wieder in unsere Dörfer zurück und zu unserer plattdeutschen Sprache. Ich spreche bis heute mit meiner Mutter und meinen älteren Geschwistern im wesentlichen plattdeutsch. Mit Rücksicht auf die weniger sprachbegabten Angeheirateten wird bei Familientreffen nicht selten kombiniert zwischen Plattdeutsch und Hochdeutsch. Es macht mir Freude, zum Beispiel mit ostfriesischen Kollegen im Bundestag am Rande platt zu küren. Artverwandtschaften verbinden hier stärker, als unterschiedliche Parteizugehörigkeiten trennen.
Eigentlich braucht man Plattdeutsch, um klarzukommen. Das wird deutlich an der kleinen Geschichte von den drei alten Leuten, die am Sonntag vor der Kirche sitzen, als ein Auto vorfährt mit einem Hamburger Kennzeichen und die Frage gestellt wird: „Können Sie mir sagen, wo es hier nach Emden geht?” Die Leute sagen nichts. Dann fragt der Fahrer: „Excuse me, can you show me the way to Emden?” Sie antworten wieder nicht. Der Fahrer versucht es auf Französisch, ohne Erfolg. Da gibt er Gas und fährt los. Eine Viertelstunde später nimmt der eine seine Pfeife aus dem Mund und sagt zu den anderen: „Det was ‘n kloken Kerl, de konn drei Spraoken.” Daor sech de annre: „Un wat hef he doarvon hat?”
Auf politischen Veranstaltungen rede ich noch heute gelegentlich platt, wenn es paßt. Als ich nach mehrjähriger Abwesenheit aus dem Emsland 1994 auf einer Ortsversammlung in Schwartenpohl in einem Feuerwehrhaus sprach und dabei hörte, wie sich einige Teilnehmer zwischendurch auf Plattdeutsch unterhielten, habe ich selbst ebenfalls platt angefangen. Das Eis, soweit es da war, war endgültig geschmolzen. Auch bei Grußworten anläßlich von Dorfjubiläen kommt mir gelegentlich Platt zur Hilfe. Als der niederländische Bund, der die in Deutschland ansässigen Niederländer organisiert, seine Jahrestagung im Kloster Frenswegen in der Grafschaft Bentheim abhielt, habe ich in meinem Grußwort darauf hingewiesen, daß mich meine Muttersprache mit ihnen verbindet. Ich wurde dann demonstrativ aufgefordert, doch weitet plattdeutsch zu sprechen, sie würden mich schon verstehen. Und so war es auch. Die Sprache verbindet einfach, schafft regionale Identität auch über nationale Grenzen hinweg, sie gibt ein Stück Halt.
Durch nichts ist die Anschaulichkeit der plattdeutschen Sprache zu ersetzen und die Möglichkeit, komplizierte Sachverhalte einfach auszudrücken. Wenn von jemandem gesagt wird, daß er ein „mojer” Kerl ist, kann dieses kaum passend übersetzt werden. Zu sagen, er wäre ein schöner Mann, gibt das Gemeinte kaum wieder, ebensowenig wie der Hinweis, er sei ein anständiger Kerl. „Moj” ist ein Stück mehr Liebenswürdigkeit.
Plattdeutsch verbindet mich im Bundestag auch heute mit Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern. Als ich jemanden halb platt reden hörte und ihn befragte, ob er nicht gebürtig wohl aus dem Westniedersächsischen komme, antwortete er mir entwaffnend: „Nein, ich komme gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern. Meinst du etwa, wir seien weniger sprachbegabt als ihr?” Wir sollten da, wo es geht, das Plattdeutsche pflegen. Ich stelle fest, daß unsere Kinder höchst neugierig darauf sind und sich auch dafür interessieren. Plattdeutsch wird angeblich von acht Millionen Menschen gesprochen. Es geht darum, auf möglichst natürliche Art und Weise das Generationenstaffelholz weiterzugeben.