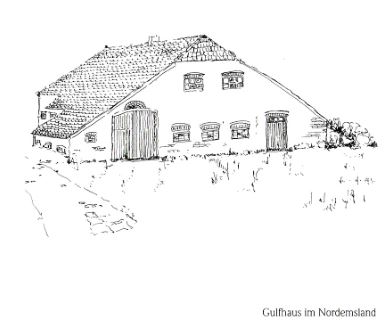Im Moor geboren an einem frostkalten Februartag im mageren Nachkriegsjahr 47. Meine Geschwister spielten auf dem eisgefrorenen Nord-Südkanal, der das Dorf durchzieht, rechts und links vom Kanal und an einigen Stichstraßen liegen die Häuser. Wo die Provinzialstraße im Ort endet, stößt sie auf die dunkle Moorkirche, links davon befindet sich das Pastorat, rechts die Schwesternstation und die Volksschule. Um dieses hochdeutsche Territorium herum, abgesehen von den Enklaven Polizist, Arzt, Zöllner und reformierte Kirche, beginnt das plattdeutsche Gebiet. Direkt an dieser Sprachgrenze in Nachbarschaft zur Schule steht mein Elternhaus. Plattdeutsch wuchs ich auf, plattdeutsch ist meine Muttersprache.
Eines Tages fuhren Möbelwagen bei der Schulleiterwohnung vor. Ein neuer Hauptlehrer mit seiner Familie hielt Einzug. In Kürze freundete ich mich mit Clemens, dem Rektorssohn an. Er verstand kein Plattdeutsch, ich sprach kein Hochdeutsch. Zum Unmut dieser Lehrerfamilie lernte nicht ich die Sprache der Gebildeten, sondern Clemens verbreitete im Elternhaus die kräftigen Sprüche der Einheimischen. Der drohende Bildungsnotstand humanistisch erzogener Kinder verdunkelte das Lehrerfamilienleben. Das sorgenvoll verhängte Begegnungsverbot mit den Platt deutschen blieb nahezu wirkungslos.
Die Schulzeit begann. Gut zwanzig Jungen und Mädchen, einer davon war ich, versammelten sich im Klassenzimmer. Der torfbefeuerte Kanonenofen verbreitete seine schweißtreibende Hitze in der näheren Umgebung, wir anderen froren in unseren gestrickten Unterhosen, in den langen, wollenen Strümpfen. Vorn stand die Lehrerin. Das Fräulein war auch „hochdeutsch”, stand unserer Muttersprache verständnislos gegenüber. Zum Glück übersetzten einige sprachbegabte Flüchtlingskinder – zumindest sinngemäß.
Sehr bald lernten wir das richtige Deutsch, die zivilisierte Sprache. Plattdeutsch war falsch, minderwertig, das rudimentäre Kommunikationsmittel der einfachen Moormenschen. Also sprachen wir im Klassenzimmer die bessere Sprache, auf dem Schulhof ging’s munter plattdeutsch weiter. Etwa so, wie heute Kinder in der Schule Englisch lernen. Unseren Eltern wurde beigebracht, Plattdeutsch ist schädlich, diese Kinder lernen schwerer, sind benachteiligt.
In Achtung vor dem „Mester” und dem „Fräulein” begann nun die sprachliche Kultivierung. In vielen Familien hielt Hochdeutsch Einzug oder das, was man dafür hielt. Bald fuhren die Kinder nach „Möppen”, sie „brachten etwas verloren”, oder mußten das „andere aufholen”…
Nach dem fünften Volksschuljahr wechselte ich in die Klasse 5 des damaligen Gymnasiums für Knaben (heute Windthorst-Gymnasium) in Meppen. Üblicherweise wiederholten Landkinder die Klasse 5, da sie – so die Meinung der Pädagogen – gegenüber den Stadtkindern entwicklungsmäßig zurückgeblieben waren. Eines hatte ich in der Schule gelernt: Niemals plattdeutsch reden. Folglich sprach ich im Gymnasium stets brav meine erste Fremdsprache Hochdeutsch und das auch auf dem Schulhof, man hätte mich sonst für einen hinterwäldlerischen Deppen gehalten und keineswegs für einen Zögling einer höheren Lehranstalt für Knaben. Aber zu Hause jenseits der Hochdeutschgrenze, da redete ich, wie mir der Mund gewachsen war – plattdeutsch.
Wir Plattdeutschen waren domestiziert: In Amtsstuben, Schule, mit „besseren Leuten” und in der Kirche sprach man das gebildete Hochdeutsch. In der Kirche, im sonntäglichen Gottesdienst war es besonders eindrucksvoll: Die Gebetssprache war Latein, die Lieder sangen wir hochdeutsch, und ebenso predigte der Pastor, aber heimlich redeten wir plattdeutsch miteinander. Dabei hätten wir doch gläubig der Fremdsprachenkenntnis des lieben Gottes vertrauen können. Aber der war für uns auch „hochdeutsch”, also ein besonderes Mitglied der „besseren Leute”.
So wuchs ich – wie fast alle Moorkinder – zweisprachig auf, eine für den Hausgebrauch, die andere in den sogenannten „höheren” Kreisen. In der Studienzeit war es kaum anders. Exotisches wie Plattdeutsch hatte keinen Platz. Lieber diskutierten wir den restringierten und elaborierten Code der New Yorker Unterschichtenkinder.
Mittlerweile hatte ich meine zukünftige Frau, Schulleitertochter und Studentin, kennen- und liebengelernt, natürlich auf Hochdeutsch. Nach Jahren bemerkten wir gegenseitig staunend, der Partner spricht plattdeutsch. Man stelle sich vor: Die Tochter eines Schulleiters spricht meine Muttersprache. Aber geheiratet haben wir auf Hochdeutsch. Ob wohl ein plattdeutsches Eheversprechen so richtig von Amts wegen gültig gewesen wäre?
Als von Amts wegen bestallter Lehrer in einem emsländischen Dorf war ich endlich mit Plattdeutsch am richtigen Ort. Vom ungewohnten Hochdeutsch wechselten wir gern ins muttersprachliche Platt. Die Vertrautheit gemeinsamer Sprache schuf eine gemeinsame Verbindung zur Bewältigung pädagogischer Probleme. Jahre später die unerwartete Erfahrung in Werpeloh, einem Dorf im Herzen des Hümmlings: Bei der Vorstellung als Schulrat beim Bügermeister Bene Albers sprach dieser ganz selbstverständlich plattdeutsch. Meiner Überraschung folgte sein Erstaunen, als eben dieser „Schaulroat” ebenso selbstverständlich in Platt antwortete. Das Selbstbewußtsein dieser Menschen im Gebrauch ihrer Sprache hat mich nachhaltig beeindruckt.
In den letzten Jahren erlebt nun meine Muttersprache eine verblüffende Renaisance. „Platt proaten is in”, „Platt lutt moij”: Bücher werden veröffentlicht und gekauft, Lieder werden geschrieben und gehört, Trachten und Tänze entdeckt und gefeiert. Hier und da wird eine festliche Rede mit plattdeutschen Sprüchen bereichert, sogar von jenen, denen diese Sprache fremd ist. Platt ist chic, Platt ist in.
Aber exotisch ist meine Muttersprache mehr denn je. Viele Kinder sprechen besser englisch als die Sprache ihrer Heimat. Jene Kulturpioniere haben doch gewonnen. Das Bourtangermoor ist kultiviert, nun sind wir es auch. Meine Heimat hat an Farbigkeit verloren, die plattdeutsche Kultur stirbt aus. Das elegante Hochdeutsch gleicht den endlosen Maisfeldern, einer Landschaft ohne Ecken und Kanten, einer Sprache ohne identitätsstiftenden Saft und ursprüngliche Kraft.
Wir sind kultiviert.