Geistiges Wurzelgefühl
An meine erste Begegnung mit der plattdeutschen Sprache kann ich mich zwar nicht erinnern, aber genau datieren kann ich sie: Es war der 12. März 1930, als ich in Thesingfeld, heute Neuenhaus/Grasdorf, das Licht der Welt erblicken durfte. Ich bin sicher, daß meine Mutter mich plattdeutsch willkommen geheißen hat. In der Familie, in die hinein ich geboren wurde, wurde ausschließlich plattdeutsch gesprochen. Somit ist dies im wahrsten Sinne des Wortes meine Muttersprache, und – um es gleich zu sagen – sie ist es bis heute geblieben.
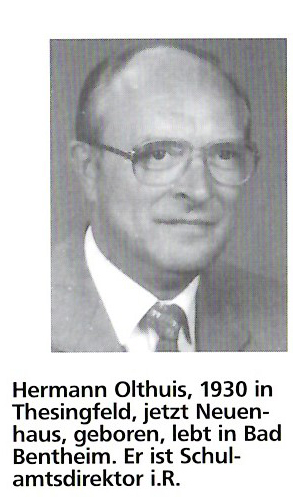
Die erste Begegnung mit der hochdeutschen Sprache erlebte ich bei meiner Einschulung 1936 in die zweiklassige Volksschule in Grasdorf. Besondere Schwierigkeiten beim Erlernen dieser ersten „Fremdsprache” – dem Hochdeutschen – sind mir nicht bewußt geworden, zumindest nicht in Erinnerung geblieben. Gewiß haben dazu in nicht geringem Maße meine Volksschullehrer Herr Götting (1. Schuljahr), Frau Hargens-Klotz (2. bis 4. Schuljahr) und Herr Vennebrügge (5. bis 8. Schuljahr) durch ihr Verständnis für plattdeutsch sprechende Kinder beigetragen.
So wuchsen wir zweisprachig auf: Neben dem Hochdeutschen im Unterricht wurde in den Pausen und auf dem Schulweg sowie zu Hause nur plattdeutsch gesprochen. Und ich habe nie den Eindruck bekommen, daß das Plattdeutsche dem schulischen Weiterkommen, auch nicht im Deutschunterricht, abträglich gewesen ist. Durch seine zum Teil recht plastische Ausdrucksmöglichkeit mag es sich sogar manchmal förderlich ausgewirkt haben.
Nach der achtjährigen Volksschulzeit blieb Plattdeutsch für mich weiter die Regelsprache, zumal ich bis zum 19. Lebensjahr auf dem landwirtschaftlichen Hof tätig war. Konfirmandenunterricht, Berufsschulunterricht und Orgelkurse bildeten einige Inseln für das Hochdeutsche. Selbst im kirchlichen Jugendverein war der Gebrauch des Plattdeutschen üblich. Das gleiche galt im von mir erteilten Harmonium- und Orgelunterricht sowie in einigen Singkreisen, die mir eine erste bescheidene finanzielle Grundlage für meinen späteren Besuch einer Privatschule und des Abendgymnasiums erbrachten.
Während der Vorbereitungszeit auf das Abitur und des Studiums an der Pädagogischen Akademie trat naturgemäß der Gebrauch des Plattdeutschen in den Hintergrund. Nicht unerwähnt aber bleiben soll, daß ich zu keiner Zeit mit meinen Eltern, Geschwistern und näheren Verwandten hochdeutsch gesprochen habe. Wo sich nur eben Nischen für das Plattdeutsche ergaben, wurden sie genutzt. In der schriftlichen Kommunikation allerdings bedienten wir uns des Hochdeutschen, was zuweilen sogar etwas seltsam anmutete.
Im übrigen verursachten notwendige, plötzliche Wechsel vom Plattdeutschen aufs Hochdeutsche keine Schwierigkeiten mehr, sie vollzogen sich quasi unbewußt. Und sollte es denn auch schaden, wenn einem einmal beim Hochdeutschen ein plattdeutscher „Ausrutscher” unterlief? Mein verehrter Deutschlehrer am Abendgymnasium mußte wohl ein feines Gespür für meine Zweisprachigkeit haben, als er meinen ersten Klassenaufsatz mit folgender Bemerkung kommentierte: „Man merkt es Ihrem Aufsatz an, wie Ihre Vorfahren mit geruhsamem Blut durch ihre Äcker gezogen sind.”
Nach der beruflichen Ausbildung blieb im privaten Bereich das Plattdeutsche vorherrschend. Meine Frau, in Uelsen geboren, sprach plattdeutsch wie ich. Wir haben nie – bis zum heutigen Tage – die Schwelle zur hochdeutschen Kommunikation untereinander übertreten können. Bei einem gelegentlichen Anlauf, uns im Hochdeutschen miteinander zu versuchen, meinten unsere Kinder: „Nein, nein, nein, sprecht bloß plattdeutsch miteinander, das klingt sonst so komisch.”
Mit den Kindern sprachen wir hochdeutsch. Warum? Es war wohl eine Modeerscheinung. Sie verstehen heute plattdeutsch, sprechen es weniger. Wie unsere Kinder es bei uns unnatürlich finden, so seltsam mutet es meiner Frau und mir an, wenn frühere Freunde und Bekannte, die wie wir mit dem Plattdeutschen aufgewachsen sind, heute meinen, untereinander oder mit uns hochdeutsch reden zu müssen beziehungsweise ihrem Plattdeutsch möglichst viele hochdeutsche Redewendungen beimischen zu müssen.
Für mich ist Plattdeutsch zwar keine starre Sprache, sie ermöglicht viele Variationen, aber Plattdeutsch muß im wesentlichen Plattdeutsch bleiben. Es ist sicher schade, daß es eine einheitliche und eindeutige Schriftsprache im Plattdeutschen nur in Ansätzen gibt. Sie würde wahrscheinlich dem Erhalt und der Förderung des Plattdeutschen zugute kommen.
In der Ausübung meiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer und auch als Schulrat ist mir das Plattdeutsche nicht selten von Nutzen gewesen. Ging es um Kontakte mit plattdeutsch sprechenden Eltern, so war es mir in der Regel eine Selbstverständlichkeit, mit ihnen plattdeutsch zu reden. Die Hemmschwelle zu gegenseitigem Verstehen war dadurch wesentlich niedriger. Oft meinten meine Gesprächspartner: „Wat, Ij könnt ok platt?”
Bei einem Besuch in einer Aussiedlerfamilie aus Kasachstan anläßlich einer Überweisung ihres Kindes in die Sonderschule stellten wir durch Zufall fest, daß wir über eine gemeinsame Muttersprache verfügten: Plattdeutsch. Diese Familie hatte sie über Jahrhunderte hinweg beibehalten. Wir bedienten uns nun weiterhin des Plattdeutschen, wenn auch ein wenig verschieden akzentuiert
Enorm wichtig war es mir, plattdeutsch sprechen zu können, wenn Erstklässler aus dem ländlichen Raum eingeschult und in der ersten Zeit unterrichtet wurden. Am ersten Schultag pflegte ich den Neulingen im Beisein ihrer Eltern immer eine Geschichte zu erzählen, natürlich eine hochdeutsche. Diesmal hatte ich mich in der kleinen Landschule für die Geschichte „Vom dicken, fetten Pfannkuchen” entschieden. Auf meine Frage an B. in Plattdeutsch: „Wees du dann ok, wat nen Pfannkuchen is?” antwortete er mir: „Nee”. Ich fragte weiter: „Wees du dann, wat nen Pannekoken ist?”, und er meinte prompt: Joawa!” B. hatte verstanden, und was noch mehr bedeutete: Er fühlte sich verstanden.
Als Jury-Mitglied bei plattdeutschen Lesewettbewerben erlebte ich vielerlei Variationen des Plattdeutschen. Es war in der Regel wohl auch festzustellen, ob eine Schülerin beziehungsweise ein Schüler von Haus aus platt spricht oder ob es eigens für den Wettbewerb erlernt war. Das sollte bei der Bewertung keine Rolle spielen. Ich habe alle Achtung vor Menschen von außerhalb, die sich in der neuen Heimat bemühen, diese hier gesprochene Heimatsprache zu erlernen, ohne ihre ursprüngliche aufzugeben. Jede Heimat – möge jeder Mensch eine haben! – hat ihre Heimatsprache. Sie hilft, Heimat zu erwerben und zu erschließen. Und: „Heimat ist geistiges Wurzelgefühl” I.E. Spranger)
