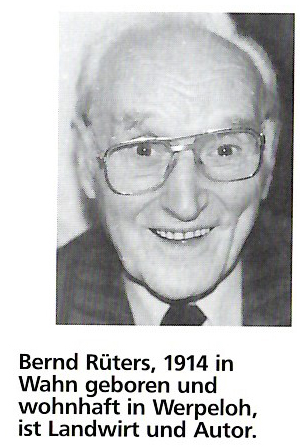Oase der Ruhe
In Wahn auf dem Hümmling bin ich am 14. 10. 1914 zur Welt gekommen und mit acht Geschwistern – vier Jungen und vier Mädchen – aufgewachsen. Bei uns im Elternhaus und in der Gemeinde wurde nur plattdeutsch gesprochen, selbst der Gemeindediener verkündete seine Bekanntmachungen meistens auf Plattdeutsch. Selbst mit dem religiösen Wort „Gott” wurden wir von unseren Eltern zuerst in Plattdeutsch bekannt gemacht. Ich erinnere mich noch gut, daß meine Mutter bei meiner jüngsten Schwester an der Wiege plattdeutsche Wiegenlieder sang. Gewiß hat sie dies auch bei mir getan, und so sehe ich Plattdeutsch als „mine Maudersprake”. Meine Eltern waren immer sehr darauf bedacht, daß wir unsere Sprache ohne Verschandelung zum Ausdruck brachten.
So war es alte Sitte, daß wir am Palmsonntag Nachbarn und Verwandten einen Palmzweig brachten, und dann wurde uns bündig mit auf dem Weg gegeben, „Guten Tag” zu sagen und: „Ich wollte euch wohl einen Palmzweig bringen”. So erhielten wir vom Elternhaus eine bestimmte Sicherheit. Ich fand es auch schön, daß wir als Jungs der Reihe nach Meßdiener wurden; so trafen wir im Dorf mit allen Begebenheiten zusammen – mit Kindtaufe, Hochzeit, Versehgang, Beerdigung, Prozessionen. Das bereicherte früh unsere Lebenserfahrung, und wir lernten mit dem Latein sogleich eine dritte Sprache sprechen.
Unser Hümmling wurde etwa um 1865 von dem Professor Dr. Heinrich Lüken aus Brual mit einer schönen Hymne bedacht: „De Hümmelske Bur”. Auf dieses Lied war der Hümmlinger stolz, weil er hier auf seine Eigenart angesprochen wurde, und darum wurde es bei allen besonderen Anlässen – auf Bauernhochzeiten, Schützenfesten – mit Inbrunst gesungen, ebenso wie die standesgemäßen Hochzeitslieder „Wo kriege wi dat op, wo kaome wi der dör, un so kriege wi’t siläwe nich weer”. Aber heute müß man sich leider fragen, was ist noch von unserer alten Eigenständigkeit übrig geblieben.
Im Jahre 1941 wurde meine Heimat Wahn wegen der Erweiterung des Krupp-schen Schießplatzes durch die Ruges geräumt. Das Hochdeutschsprechen war bis dahin verpönt. Folgende Begebenheit wurde damals von den Dorforiginalen am letzten Herdfeuer in „011mannsköeke” zum Besten gegeben: Eine Frau ging mit ihrem Sprößling über die Öewerenderstraote, auf der zweimal am Tag mehrere Kuhherden zur Weide und wieder zurück getrieben wurden. Der kleine Junge fand es lustig, von oben in die dicken Kuhfladen zu treten, und die Mutter rief entsetzt: „Kind, tret’ nicht ins Kuh-A-A!” Der Junge fragte: „Was, Mama?”. Dieses Spiel
wiederholte sich ein paarmal, bis das Maß voll war und die Mutter voller Zorn rief: „Ach Junge, nu trett doch nich in de Kauhschiete!” – „Ach so, Mama!”
In der Hektik unserer Tage, wo mit dem Fortschritt so viele neue Fremdwörter in Umlauf kommen, empfinden viele Menschen unser emsländisches Plattdeutsch als eine Oase der Ruhe. Leider verliert unser Plattdeutsch durch Aufgabe alter Arbeitsmethoden viel an altem Sprachschatz, aber es bleibt doch lebendig.
Ich erinnere mich an die Kriegszeiten und die Gefangenschaft im Ural. Es waren Momente, die man nicht vergißt, wenn man plötzlich mit jemandem platt sprechen konnte. Dann spürte man Wärme und Vertrauen, und man wollte sich wohl gegenseitig festhalten. Eines darf ich mit Sicherheit sagen: Die Freundschaft, die über unser emsländisches Platt zustande kam, war für mich immer von Dauer.
In unserem ursprünglichen Sprachgebrauch ist vieles aus dem Umgang mit der Tierwelt entstanden. So hat eine alte Bäuerin aus Werpeloh das Nahen eines Gewitters mit den besorgten Worten so treffend geschildert: „0 Heer, o Heere, watt kummp de Lucht dor jäe so bäisteräffteg upkälwern!” Zu dieser erregten bildlichen Schilderung möchte ich den folgenden Hinweis geben. Einem Gewitter stand man in früherer Zeit, als noch fast alle Häuser ein Strohdach ohne Blitzableiter hatten, mit großer Sorge gegenüber – vor allem, wenn sich riesige, helle Wolkentürme vor einem pechschwarzen Hintergrund auftürmten.
Zu dieser unheimlichen Schilderung kommt folgender Beweggrund hinzu: Noch in meiner Kinderzeit war es eine furchterregende Tatsache, wenn bei der Geburt im Kuhstall nach der Wasserblase die feinknöchigen Beine des Kalbes zum Vorschein kamen. Dann hieß es erschreckend: „Dät is jäe äin Stäinbilln!”, also ein sehr starker, muskulöser Doppelender. Das hieß dann: Es mußten alle kräftigen Männer aus der Nachbarschaft zusammengerufen werden, denn es stand eine schwere Geburt bevor. In sehr vielen Fällen ging das Muttertier oder die Färse dabei zugrunde, und der Verlust war so groß, daß ein Bauer seinem Knecht (Gehilfen) den Jahreslohn damit hätte bezahlen können. Die Geburt eines Doppelenders lag damals sehr in der alten Rasse begründet und wurde somit von der Bäuerin bildlich dargestellt: „Bäisteräffteg upkälwern.”
Als abgehender Sohn fand ich 1951 auf dem Hümmling in Werpeloh meine neue Heimat. Zunächst bin ich jedem kleinen Fingerzeig nachgegangen, die älteste Geschichte meiner verlassenen Heimat Wahn über die Staatsarchive aufzuspüren, und hatte dabei Glück, Dokumente über Lehnsherrschaft, Wehren und Sling, also die älteste Geschichte meiner Heimat ausfindig zu machen. Ich bekam auch noch Verbindung mit dem Nachfolger des ersten Lehnsherrn, Pierau de Pinnink aus Brüssel – eine Anknüpfung an eine Zeit, die mehr als 300 Jahre zurückliegt.
Über die Heimatgeschichte von Wahn lernte ich den Heimatforscher Maier-Well-mann und den Herrn Katastertechniker Rötgers, Sögel, mit der Flurnamenfor‑