Von den plattdeutschen Sahnehäubchen
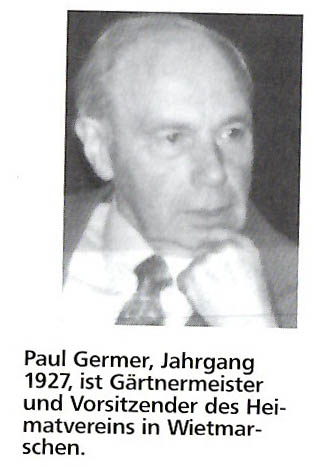
Als ich 1933 eingeschult wurde, war bis dahin meine gebrauchte Sprache das Wietmarscher Platt. Die junge Lehrerin, noch nicht lange in Wietmarschen und eine feine junge Dame, brachte uns die ersten hochdeutschen Worte bei. In der ganzen Schule waren etwa fünf bis acht hochdeutsch sprechende Kinder; sie waren zugezogen.
Selbst der Hauptlehrer und Pastor, beide schon lange am Ort, sprachen platt und wurden auch so angesprochen. Dagegen kannten junge Lehrkräfte, die hierher kamen und oft braun angehaucht waren, nur den plattdeutschen „Schlachtruf”: Lewer dot es Slaw. Der Ortspolizist wiederum, seit 1932 im Ort, verstand bald das Platt, sprach es aber nicht. Dann gab es etwa zehn sogenannte Landhelfer, die zum Teil für Jahre bei den Bauern eingesetzt wurden. Sie stammten aus dem Kohlenpott und lernten recht bald die plattdeutsche Sprache zu verstehen. Ende 1939 kamen für etwa vier Monate Soldaten zur Einquartierung, und schon herrschte in den Gaststätten das Hochdeutsche vor. Im folgenden Jahr wurden schon die ersten Kriegsgefangenen (Belgier) bei den Bauern eingesetzt. Diese fremden Menschen lernten ein abgehacktes Plattdeutsch. Da sie auch Radio hörten, kam nach einigen Jahren eine sonderbare Sprachmischung zustande. Es war ein Gefangenendeutsch, und ich verfalle noch nach über 50 Jahren in diesen „Slang”, wenn ich mit Belgiern in den Ardennen spreche. Gegen Ende des Krieges als Soldat und Kriegsgefangener zählte nur die hochdeutsche Sprache. Traf man jedoch einen Plattdeutschen, so war es gleich etwas heimatlicher.
Nach dem Krieg hatte sich vieles verändert. Vertriebene und Flüchtlinge waren auf dem Lande, und auf den Höfen kam man mit dem Plattdeutschen nicht mehr aus. Aus „Erpel gaddern” wurde „Kartoffel klauben” oder „Kartoffel lesen”. Später, während der Umschulung vom Landwirt zum Gärtner, herrschte das Hochdeutsche vor. Mit vielen Menschen und Dialekten kam ich damals in Berührung, fand aber immer wieder zum heimatlichen Platt zurück.
In der Zeit um 1950 begann für unsere Sprache der große Wandel. Plötzlich sprach man mit den Kindern die hochdeutsche Sprache. Dies war auch für die Eltern und Großeltern eine große Umstellung, die unter sich noch das Platt benutzten. Meine Kinder erlernten noch die Sprache der Eltern, aber es war selbstverständlich, daß sie mit vielen fremden Menschen, Radio und Fernsehen in Berührung kamen und so das Hochdeutsche ganz von allein erlernten. In der Schule hatten sie keine Nachteile und konnten auch zu weiterführenden Schulen gehen.
Schon vor dem Krieg gab es viele plattdeutsche Schreiber in der Grafschaft und im Emsland. Es müssen Idealisten gewesen sein, war doch das Althergebrachte noch gar nicht in großer Gefahr. Ihnen ist es sicher leichter gefallen, die überlieferte Sprache zu bewahren, denn sie konnten bei alten Menschen nachfragen. Anfang der 50er Jahre, als sich der Verfall in unserer schönen Sprache deutlich zeigte, griffen wiederum Männer und Frauen zur Feder. Daher habe ich den Eindruck, daß wohl kaum eine Region so viel für das alte Platt getan hat wie die unsrige. Heimatvereine versuchen, der alten Sprache immer wieder neue Würze zu geben. Auch das Sammeln von alten Wörtern und Redensarten ist nützlich. Bedenken habe ich allerdings gegen das Umsetzen neuer Wörter in unser Plattdeutsch: zum Beispiel für Fernsehen „Kiekkasten” oder „Huhlbessen” für Staubsauger. Es hat sich erwiesen, daß dabei nichts Einheitliches erzielt werden kann.
Seit etwa 20 Jahren mache ich Führungen im Stiftsbezirk und neuerdings auch im Packhaus (Heimathaus) von Wietmarschen. Je nach Wunsch halte ich die Vorträge in Hochdeutsch oder Platt und finde viele zufriedene Besucher. Holländische Besucher aus der Grenzregion werden immer in Platt angesprochen. Ganz ohne hochdeutsche Worte kommt man jedoch selten aus. Andererseits sind auch hochdeutsche Führungen oft mit platten Ausdrücken und Sätzen durchsetzt. Ein Lehrer bestätigte mir erst kürzlich, daß die plattdeutschen Ausdrücke die „Sahnehäubchen” meines Vortrags gewesen seien.
Plattdeutsche Theaterstücke, Vorträge und auch Beiträge in örtlichen Zeitschriften sollten immer im jeweiligen Ortsplatt gehalten werden. Die Aussichten für unser Platt in den Schulen schätze ich gering ein. Der Sprachschatz wird immer weniger. Der tägliche Umgang mit der Technik läßt eine plattdeutsche Sprache fast nicht mehr zu. Für mich ist und bleibt es jedoch immer eine Freude, unser Plattdeutsch zu sprechen, auf kleine Unterschiede – sogar in der Gemeinde – zu achten und bei fremden Plattsprechern zu erraten, wo sie wohl herkommen.
