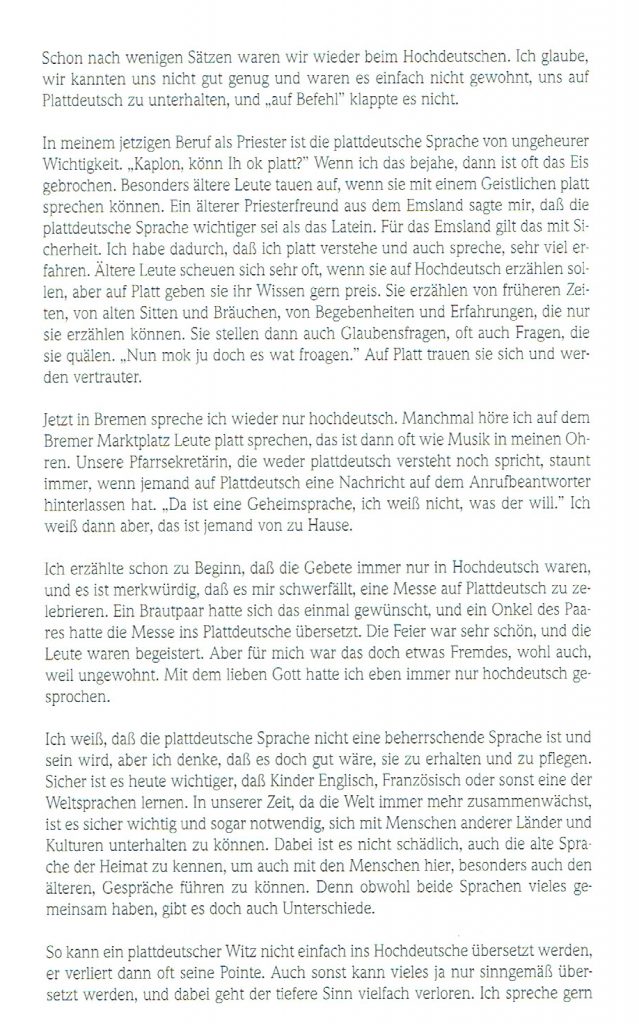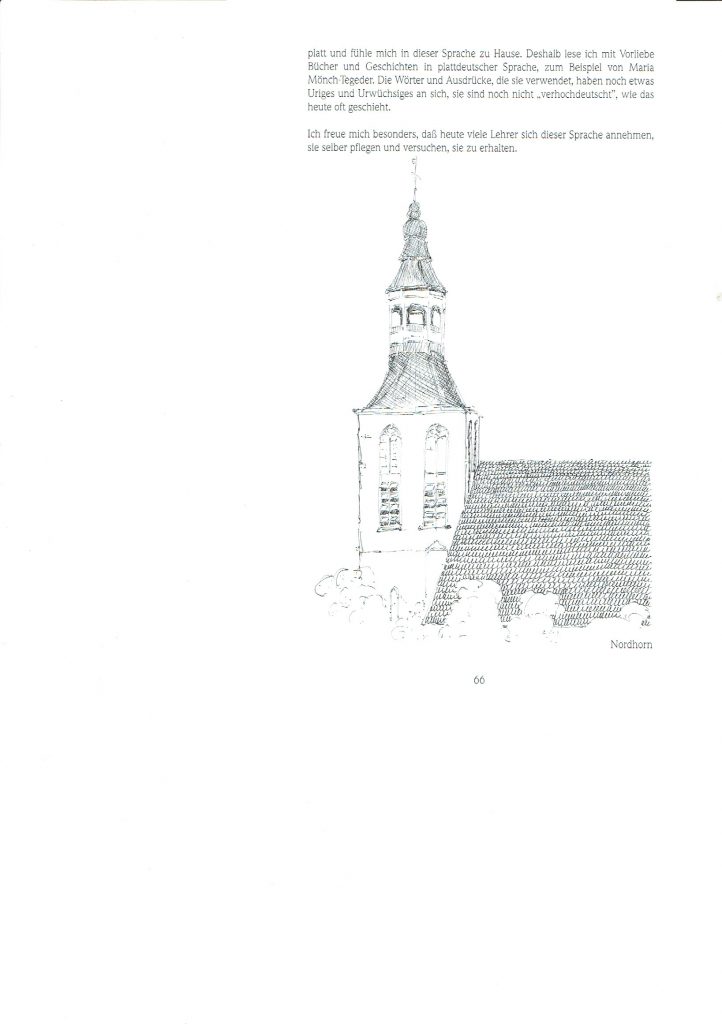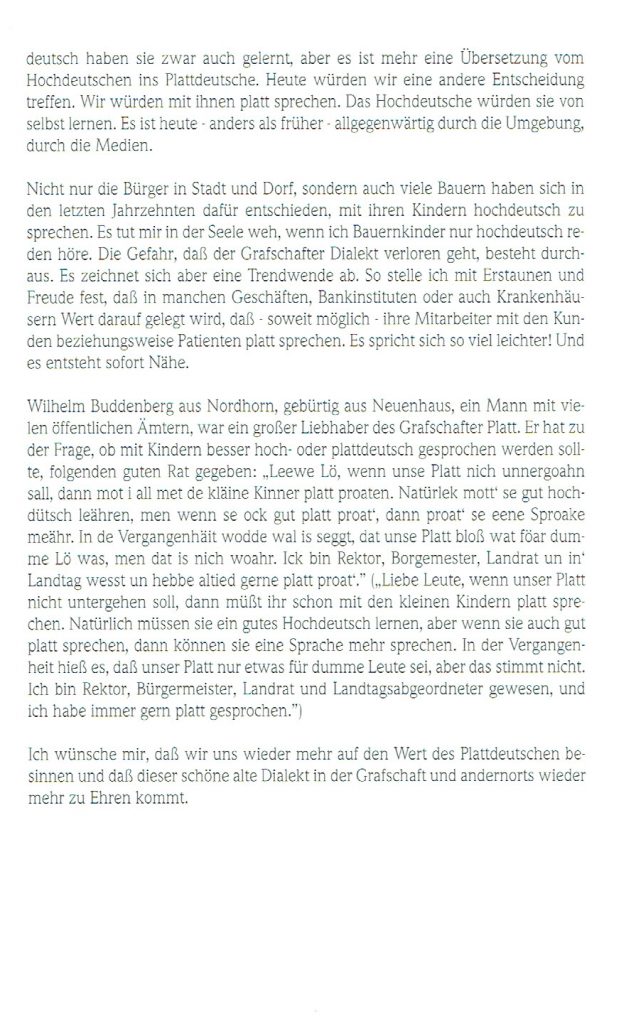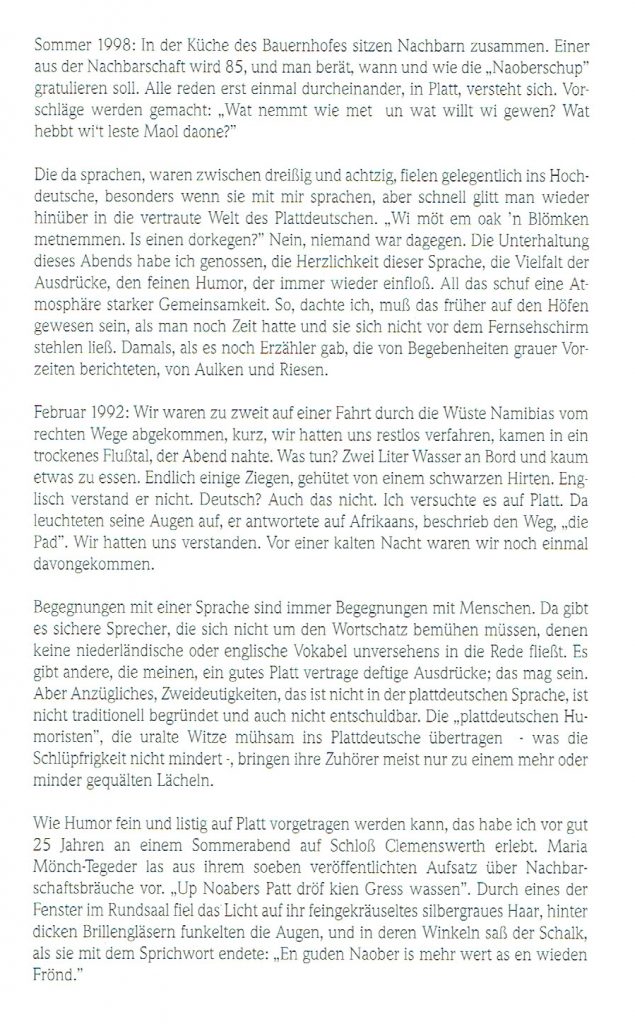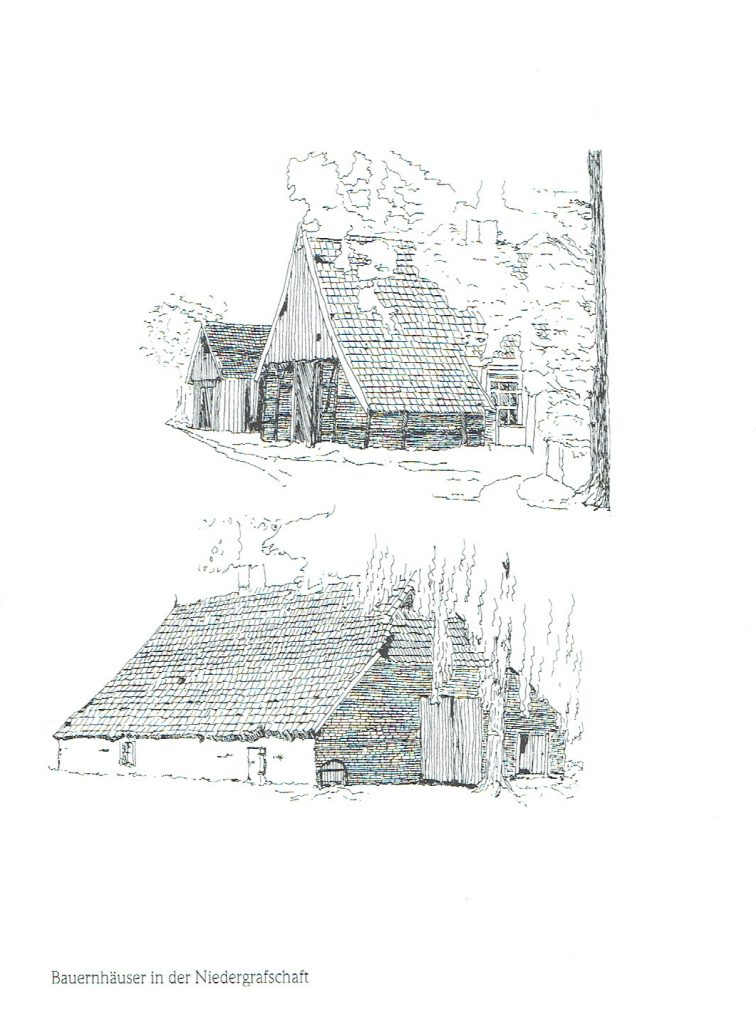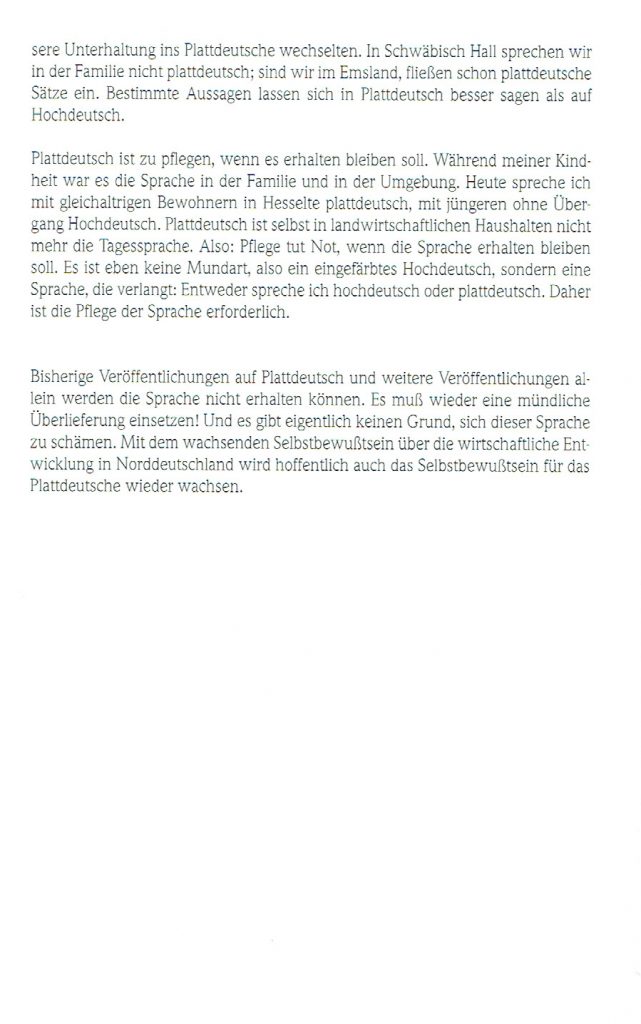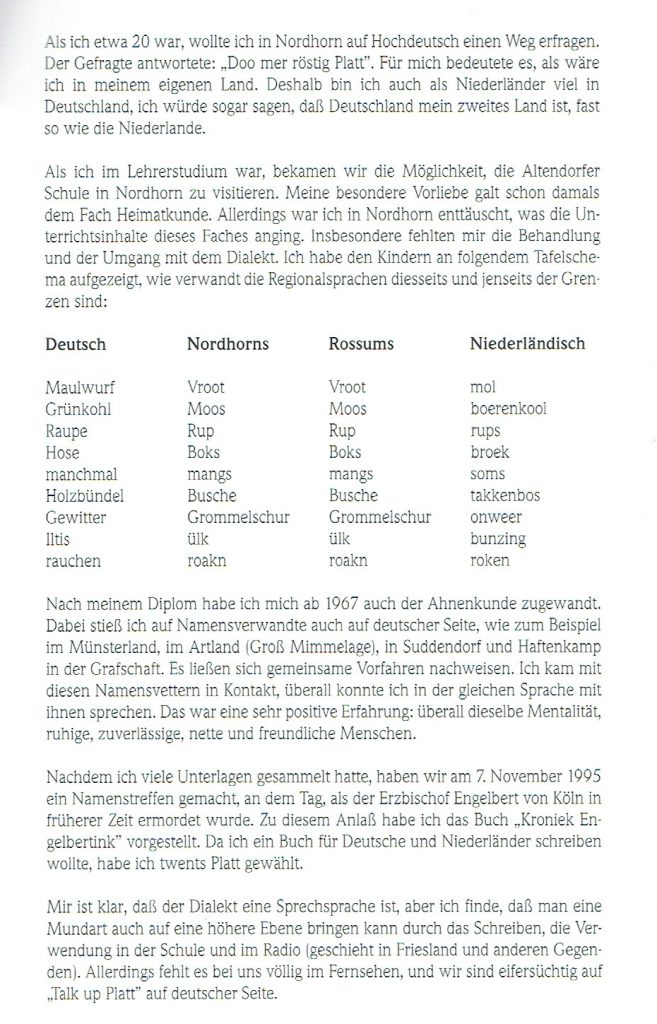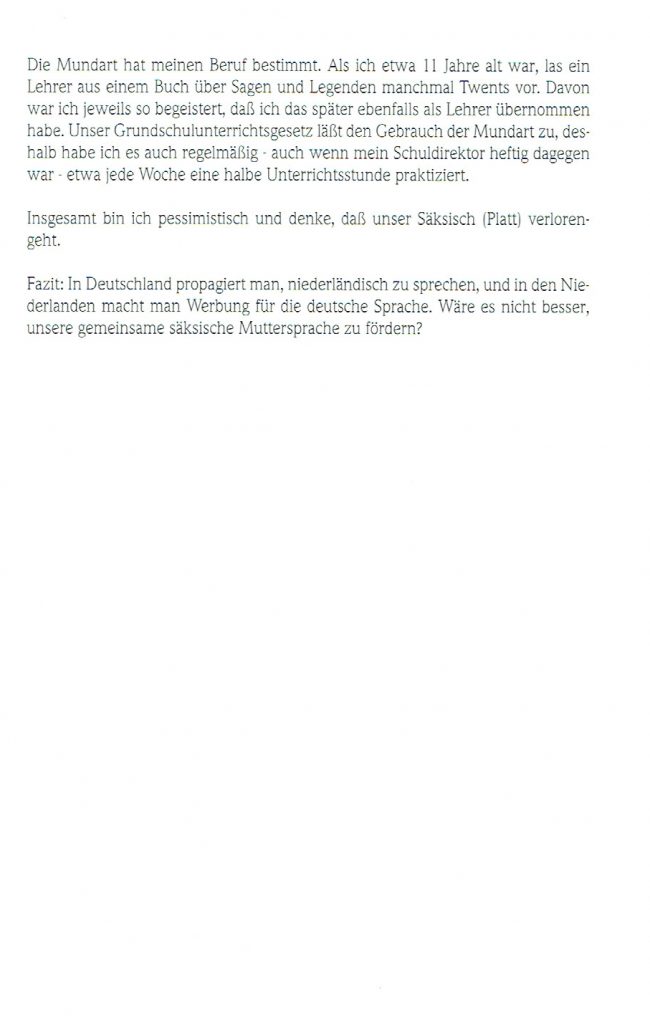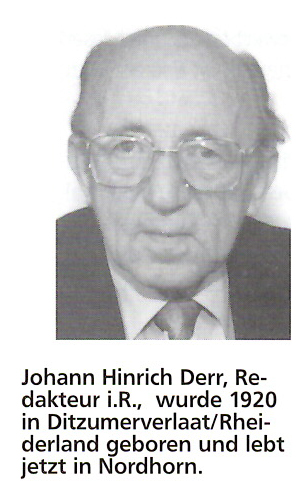Bernd Gels
Fenne Friedrich
Werner Franke
Hermann Fenbert
Mariele Fasselt
Hennie Engelbertink
Dr. Andreas Eiynck
Maria Dühnen
Eine Sprache stirbt
Meine Eltern und Großeltern waren sicherlich überrascht und etwas befremdet, bestimmt aber auch amüsiert, als ich im Alter von vier oder fünf Jahren beschloß, ab sofort nur noch hochdeutsch zu sprechen. Da ich in Flechum (heute ein Ortsteil von Haselünne) in einer emsländischen Familie aufgewachsen war, hatte ich natürlich mit meinen Angehörigen und anderen Dorfbewohnern bisher nur platt gesprochen, so wie es überall in den dörflichen Regionen des Emslandes Anfang der 50er Jahre selbstverständlich war.
Hochdeutsch – ja sicher, das war mir nicht ganz fremd: Gesungen wurde meistens hochdeutsch, vor allem in der Kirche. Auch meine Eltern kannten anscheinend viel mehr hochdeutsche als plattdeutsche Lieder. In meiner Erinnerung sangen meine Eltern oft, sowohl bei der Arbeit als auch mit uns Kindern, und einige der plattdeutschen Texte sind mir noch heute geläufig. Hochdeutsch gesprochen wurde dagegen in meinem Umfeld selten; Radio oder gar Fernsehen gab es zu Hause nicht, und ich kannte zunächst nur wenige Menschen, die hochdeutsch redeten: den Pastor, den Arzt und die „Zugezogenen”, vor allem die.Flüchtlinge. Mit zwei Töchtern von „Zugezogenen” freundete ich mich an, entdeckte dadurch wohl für mich die hochdeutsche Sprache und probierte sie aus.
Als ich in die Schule kam, erhielt das Hochdeutsche einen ganz neuen Stellenwert: In der Schule sprach man mit der Lehrerin hochdeutsch! Zum Glück konnte sie auch Platt, sonst hätten einige Mitschüler(innen) sicherlich Schwierigkeiten bekommen, sich verständlich zu machen, und es war offenkundig, daß manche Jungen und Mädchen sich während ihres ganzen Schullebens nicht mit der ihnen aufoktroyierten hochdeutschen Sprache verwachsen fühlten. Dieses Problem bedrückte mich nicht; zum einen hatte ich ja schon Hochdeutsch „geübt”, zum anderen wurde ich schnell noch besser mit der hochdeutschen Schriftsprache vertraut, da ich damals schon eine unermüdliche Leseratte war. Auf dem Schulhof aber und im Alltagsleben war das Plattdeutsche die normale Umgangssprache, und auch ich bediente mich ihrer bald wieder – der Reiz des Neuen verging schnell.
Wer hochdeutsch („dütsk”) sprach, war entweder Amtsperson (Pastor, Lehrer), oder er war kein richtiger Emsländer. Und weil die Flüchtlinge, zu denen ich Kontakt hatte, durchweg evangelisch waren, die einheimischen Bauern- und Heuer-mannsfamilien dagegen ausnahmslos der katholischen Kirche angehörten, zog ich aufgrund meiner kindlichen Spracherfahrung die für mich logische Schlußfolgerung: Plattdeutsch sprechen nur die Katholiken!
Je weiter die schulische und berufliche Bildung voranschritt, umso mehr wurde das Platt vom Hochdeutschen verdrängt. Sprach man in der kleinen Dorfschule noch platt mit den Mitschülern, so war das in den weiterführenden Schulen schon nicht mehr üblich. Haselünner Jugendliche sprachen im Gegensatz zu den Dörflern ihrer Umgebung hochdeutsch, und wollten wir integriert werden, mußten wir uns auch sprachlich anpassen.
Aber auch auf den Dörfern war der Siegeszug des Hochdeutschen unaufhaltsam, nicht zuletzt, weil insbesondere jüngere Lehrkräfte den Eltern den negativen Einfluß des Plattdeutschen auf die Schullaufbahn ihrer Kinder aufzeigten und damit indirekt aus pädagogischen Gründen dem Plattdeutschen den Todesstoß versetzten. Sie forderten und förderten den Gebrauch der hochdeutschen Sprache in den Familien. Platt zu sprechen wurde unmodern, galt als rückständig oder gar dumm.
In den Nachbarhäusern ging es nun zweisprachig zu: Mütter und Väter plagten sich, mit ihren Kindern hochdeutsch zu reden – in der löblichen Absicht, ihnen einen guten Start ins Schulleben zu ermöglichen; im übrigen wurde aber nach wie vor platt gesprochen. Heute glaube ich, für so manches Kind wäre es besser gewesen, die Eltern hätten ihm weiterhin gutes Plattdeutsch beigebracht und der Schule die Vermittlung des korrekten Gebrauchs der hochdeutschen Sprache überlassen.
Meine Eltern ließen sich von den reformpädagogischen Ansätzen jedenfalls nicht überzeugen, sie sprachen mit uns Kindern – auch später mit meinen um einiges jüngeren Geschwistern – nur platt, und bis heute ist Plattdeutsch unsere Familiensprache geblieben. Selbst meine seit mehr als 20 Jahren in Südafrika lebende Schwester fällt sofort ins Plattdeutsche, wenn wir miteinander telefonieren, obwohl sie in Kapstadt bestimmt keine Gelegenheit hat, ihre Muttersprache anzuwenden. Unterhaltungen zwischen uns Geschwistern werden als steif und unpersönlich empfunden und büßen zu viel von ihrer treffenden Ausdruckskraft ein, wenn wir sie hochdeutsch führen. Wir haben es – vor allem mit Rücksicht auf meine ausländischen Schwägerinnen – dann und wann probiert, sind aber sehr schnell wieder zum Plattdeutschen übergegangen.
Sprachen meine Eltern mit uns ausschließlich plattdeutsch, so gilt das keineswegs für die nächste Generation. Ihre Enkel(innen) wachsen hochdeutsch auf. Ihnen fehlt der unmittelbare Zugang zum Plattdeutschen, das nicht ihre Muttersprache ist. Zwar verstehen sie es, sprechen können sie es aber nicht. So ist meine Generation wohl die letzte, die das Plattdeutsche noch als lebendige Sprache, alltägliches, selbstverständliches Kommunikationsmittel mit sozialer Funktion erfahren hat und (noch) anwendet, allerdings mit der Einschränkung, daß es für viele kaum noch eine Bedeutung in der beruflichen Realität hat.
So manches Mal habe ich aber erfahren, daß der Gebrauch der plattdeutschen Sprache bestehende Barrieren abbaut. Sie wirkt wie ein Schlüssel, ein Passwort, das den Zugang öffnet und Vertrauen schafft. Wenn zwei Menschen miteinander platt sprechen, haben sie nicht nur einen gemeinsamen Zeichenvorrat, über den sie sich verständigen können, sondern das Beherrschen dieser Sprache signalisiert gleichzeitig ein großes Maß an ähnlichen sozialen Erfahrungen und schafft dadurch eine unmittelbare Vertrauensbasis, so daß auch keine Notwendigkeit für die Anwendung einer distanzierenden Höflichkeitsform besteht. Ich bin sehr dankbar, daß ich diese Erfahrungen machen und mich in beiden deutschen Sprachen heimisch fühlen darf, und empfinde um so mehr Trauer darüber, daß das Plattdeutsche untergehen wird.
Die plattdeutsche Sprache stirbt. Der Wortschatz verringert sich rapide, viele Begriffe, die meine Großeltern noch verwendeten, sind heute schon weitgehend vergessen, neue Wörter werden nicht mehr geprägt, sondern aus dem Hochdeutschen oder gar Englischen übernommen. Die heutige Schülergeneration des Emslandes versteht wenigstens noch plattdeutsch, kann es aber nicht mehr an ihre Kinder weitergeben. Ein plattdeutscher Schwank im Fernsehen oder auf einer Dorfbühne kann die Sprache nicht erhalten, reduziert sie unzulässig auf das Derb-Komische und läßt vergessen, wie lyrisch-poetisch, elegisch, sensibel, dramatisch oder sachlich-informativ Plattdeutsch sein kann.
Da das Plattdeutsche im Alltagsleben meiner Nichten und Neffen und ihrer Altersgenossen nicht mehr gesprochen wird, gehört es bald der Vergangenheit an. Vor kurzem hörte ich zu meiner großen Überraschung und Freude, daß ein Ehepaar aus meinem Bekanntenkreis mit seiner vierjährigen Tochter plattdeutsch sprach. Von der Mutter mußte ich jedoch erfahren, daß das Kind nun dabei ist, seine Eltern zum Hochdeutschen umzuerziehen.
Johann Hinrich Derr
Plattdeutsch ist Anker
„Nun sprecht doch endlich wieder hochdeutsch! Ich kann das Plattdeutsche ja nicht verstehen”, so maulte ich als Dreikäsehoch, wenn wir aus Ostfriesland, der Heimat meiner Eltern und wo auch ich das vielzitierte „Licht der Welt” erblickte, nach dem Besuch meiner Großeltern am Dollart ins Emsland zurückkehrten. Als Zöllner hatte mein Vater dort an der holländischen Grenze seinen Dienst zu verrichten und den Schmugglern das Handwerk zu legen.
Mutter und Vater, plattdeutsch aufgewachsen, sprachen hochdeutsch, um mir, so meinten sie, später Schwierigkeiten im Deutschunterricht in der Schule zu ersparen. So wuchs ich also „Hochdeutsch” auf. Natürlich waren die Omas und Opas bei ihren Besuchen bemüht, mit ihrem Enkel „duits tau proaten”. Nicht selten war es „Missingsch”, bereitete die „Übersetzung” plattdeutscher Ausdrücke ins Hochdeutsche Schwierigkeiten, und oft wurde bei Mißverständnissen herzhaft gelacht.
Nun, in der Volksschule in Aschendorf und Papenburg und später am Gymnasium der Kanalstadt, war Plattdeutsch „Fremdsprache”, ein Buch mit sieben Siegeln. Neben Latein, Englisch und Französisch hatte Plattdeutsch nichts zu suchen. Und im Deutschunterricht? Althochdeutsch ja, doch Plattdeutsch wurde ignoriert.
Mein Interesse am Plattdeutschen in Wort und Schrift wurde geweckt, als ich nach Jahren des Krieges und der Gefangenschaft im Juli 1948 heimkehrte. Meine Eltern hatte es über Hannover – „nach dort versetzt, um ausgebombt zu werden”, pflegte mein Vater zu sagen – in die Zollwohnung im Kloster Frenswegen bei Nordhorn verschlagen. Durch meine journalistische Tätigkeit lernte ich nicht nur Land und Leute kennen, sondern auch die plattdeutsche Sprache.
Die Klosterbauern machten mich mit ihrem „utmekaar” (auseinander), „dörme-kaar” (durcheinander), „vörmekaar” (in Ordnung) und manch anderem „…mekaar” neugierig. Auch mußte ich mich, hatte ich auf dem Lande zu tun, mit den Leuten unterhalten. Und da brach das Plattdeutsche das Eis dem Fremden gegenüber. Plötzlich war ich nicht mehr der neugierige Zeitungsmann, sondern einer von ihnen.
Wie im Grafschafter Land erging es mir später auch im südlichen Emsland. Sprachbarrieren gab es nicht, nur Unterschiede im Dialekt. Kurzum, ich lernte die plattdeutsche Sprache mehr und mehr schätzen, und gern las ich, was plattdeutsche Autoren in der Heimatliteratur zu Papier brachten.
Mein Fazit: Plattdeutsch ist gewachsene Sprache, alt und vertraut, deftig und kräftig, doch niemals gemein. Voller Wärme ist sie und voll Gemüt, verwachsen mit Land und Leuten. Plattdeutsch darf als Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart nicht zusammenbrechen, nicht untergehen, nicht zerstört werden. Plattdeutsch ist Teil der Geschichte des Raumes und seiner Menschen, hat Tradition. Die Überlieferung gilt es zu wahren. Die Pflege des Plattdeutschen kann und sollte dazu beitragen, die alte Muttersprache zu erhalten, ihr eine Heimstatt in unserer unruhigen Zeit und Welt zu geben. Plattdeutsch gehört zur Heimat, ist Teil der kulturellen Umwelt, ist Anker. Braucht es da noch Mut, sich zur plattdeutschen Sprache zu bekennen, sich mit ihr zu identifizieren?
Aus: Wat de kann Platt? Emsländer und Grafschafter über ihre Mundart Hrsg: Theo Mönch-Tegeder/Bernd Robben Emsbüren 1998 Verlag Mönch & Robben Seite 46