Die Blamage mit der Beschüte
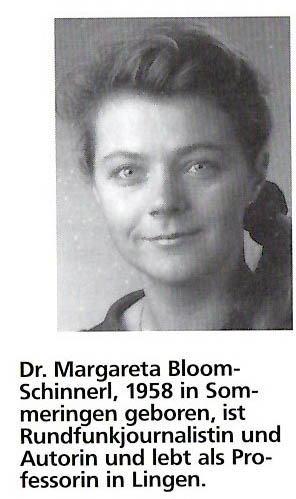
In dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, wurde damals – vor Jahrzehnten – noch überall plattdeutsch gesprochen. In den Familien, im „Dorfladen”, beim Schuster und beim Bürgermeister… Das war völlig selbstverständlich, niemand nahm Anstoß daran. Im Gegenteil: wer hochdeutsch sprach, galt als affektiert und arrogant, als Städtker, der sich qua Sprache aus der Dorfgemeinschaft ausschloß.
Bei uns im Hause wurde auch plattdeutsch gesprochen – vor allem von den Großeltern -, mit uns Kindern jedoch sprach jedermann hochdeutsch. Daraus resultierte, daß wir Kinder das Plattdeutsche zwar sehr wohl verstanden, es aber nie aktiv sprachen. Bis auf einzelne Worte und Redewendungen. Eines jener plattdeutschen Worte, die wir ganz selbstverständlich in unseren hochdeutschen Wortschatz integriert hatten, brockte mir eine nie vergessene Blamage ein. Das war so: Im Deutschunterricht des Gymnasiums, Klasse 5 – also werde ich so um die zehn Jahre alt gewesen sein – ging es darum, Wörter zu sammeln, die irgendwas mit „Brot” zu tun haben. Brötchen, Semmeln, Zwieback, Kuchen, Kekse… die Wortmeldungen kamen von allen Seiten, die Liste der Synonyme und der bedeutungsverwandten Bezeichnungen wurde lang und länger, bis allmählich keinem Schüler und keiner Schülerin mehr etwas dazu einfiel.
Ich wunderte mich die ganze Zeit, weil niemand das Wort genannt hatte, das mir als allererstes dazu einfiel. Etwas, das bei uns in der Familie täglich auf dem Tisch stand. Insbesondere mein Großvater aß es mit Genuß, indem er es – bevor er es zum Mund führte – in seine warme Milch eintunkte. Beschüte! Ganz klar, Be-schüte gehörte doch wohl auch eindeutig zu den Dingen, die etwas mit Brot zu tun haben! Da also niemand meiner Mitschüler auf diese naheliegende Idee gekommen war, hob ich nun meinen Finger. Der Deutschlehrer blickte mich fragend an und voller Genugtuung, daß ich diejenige war, der das Naheliegendste einfiel, sagte ich: „Beschüte!”
Der Lehrer zog seine Stirn in Falten, blickte mich zweifelnd an und – – – verstand mich offensichtlich nicht! Ich begriff die Welt nicht mehr! Wieso kannte der I.eh rer keine Beschüte, die doch bei uns – ich schwöre – tagtäglich auf dem Tisch stand? Ich wiederholte: „Beschüte.” Ein Mitschüler lachte laut und rief: „Das ist doch plattdeutsch. Beschüte heißt Zwieback!” Klar, daß die ganze Klasse losgrölte, und ich – eines der wenigen Kinder, das aus einem Dorf kam und in der Stadt zur Schule ging – wäre am liebsten vor Scham in den Erdboden versunken.
Ich erinnere mich auch noch daran, wie eines Tages die Großmutter der Nachbar-kinder zu uns kam und meinem Bruder fünf Mark anbot – verbunden mit der Auflage, täglich hochdeutsch mit ihren Enkeln zu sprechen. Denn im Nachbarhaus wurde ausschließlich plattdeutsch gesprochen, und darunter litten die schulischen Leistungen der Kinder.
Vor einiger Zeit bin ich – nachdem ich zwei Jahrzehnte in einer Großstadt gelebt habe – zurückgekehrt ins Emsland. Mein ältester Sohn, damals 8 Jahre alt und eine echte Großstadtpflanze, meldete sich – kaum daß er hier eingeschult war – zur Teilnahme an einem Lesewettbewerb in plattdeutscher Sprache an. Das imponierte mir sehr! Denn Plattdeutsch war für ihn so etwas wie eine Fremdsprache. Den Text, den er von seinem Lehrer zum Üben bekam, mußte ich ihm zunächst übersetzen, damit er den Inhalt überhaupt verstand. Unverdrossen jedoch übte er täglich den plattdeutschen Text – Schwierigkeiten gab es vor allem bei der Artikulation und bei seiner Sprachmelodie, die nichts, aber auch gar nichts gemeinsam hat mit der typisch plattdeutschen. Er erntete denn auch keine Lorbeeren beim schulischen Vorlesewettbewerb!
Sprache und Grammatik meines Sohnes waren bereits so gefestigt, daß das Plattdeutsche ihm nichts mehr anhaben konnte. Anders bei meiner fünfjährigen Tochter, auf deren Sprachstil, fehlerlose Grammatik und reichen Wortschatz ich so stolz war. Innerhalb kürzester Zeit begann sie mit merkwürdigen Pluralbildungen – Onkels, die Lehrers -, verleibte grammatikalische Fehler – unseres Haus – und andere fragwürdige Wendungen in ihre Sprache ein – das bin ich in Schuld. Mit fünf Jahren ist die grammatikalische Sprachstruktur offensichtlich noch nicht so gefestigt, daß sie unanfechtbar ist. Es kostete Mühe und Zeit, die grammatikalischen Irritationen meiner Tochter wieder zu glätten.
Meine nächste Begegnung hier mit der plattdeutschen Sprache war eine Sendereihe für die Ems-Vechte-Welle, dem hiesigen Offenen Kanal. Ich traf mich einmal in der Woche mit Seniorinnen und Senioren, die über frühere Zeiten sprachen, auf Plattdeutsch. „Früher gaft dat nick”- daraus entstanden mehrere einstündige Radiosendungen. Themen waren zum Beispiel: „Schoole in de Hitlertied”, „Kriegsende in’t Emsland”, „Speck för’n Fahrradreifn up`n schwatten Markt in de 40er” und „Brutlöh und Hochtied früher”. Diese Arbeit wuchs mir sehr schnell ans Herz, weil sie viel mit mir und meinen Wurzeln zu tun hatte. Und dazu gehört unabdingbar die plattdeutsche Sprache.
Meine Haltung zur plattdeutschen Sprache heute ist sehr ambivalent: Einerseits ist sie mir vertraut, vertraut im positiven Sinne des Wortes, die Sprache meiner Heimat, in der ich meine Wurzeln habe – andererseits halte ich die plattdeutsche Sprache für sehr hinderlich bei der Ausbildung eines guten Sprachstils.
Das Plattdeutsche hat etwas von einem geschlossenen Code, ist eine Sprache für Eingeweihte, signalisiert Dazugehörigkeit und läßt Fremde erst mal draußen stehen – wie jeder andere Dialekt und jede andere Mundart auch. Wer plattdeutsch spricht, offenbart damit zugleich eine bestimmte Lebens- und Weltsicht, die viel mit Tradition, Althergebrachtem, Abgrenzung und Vereinfachung zu tun hat. In der plattdeutschen Sprache ist kein Raum für großartige Gefühle – wohlgemerkt: ich meine die Sprache, nicht die Menschen. Denn die haben sehr wohl großartige Gefühle, nur sie reden nicht gern darüber. Ick mach di heller lien – ist vermutlich das ausdrücklichste Liebesbekenntnis, das in plattdeutscher Sprache möglich ist. So gesehen paßt sie zu den Emsländern: Sie meiden die großen Worte und fürchten die Sentimentalität oder auch „Gefühlsduselei”.
So is dat! Ferrich.

