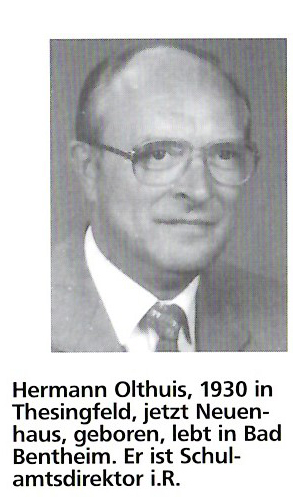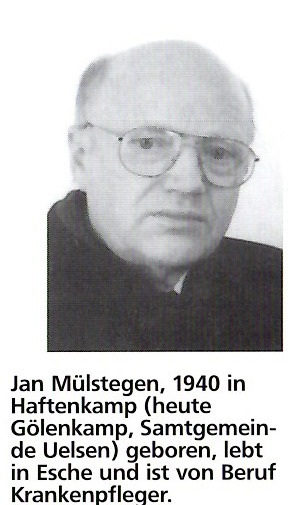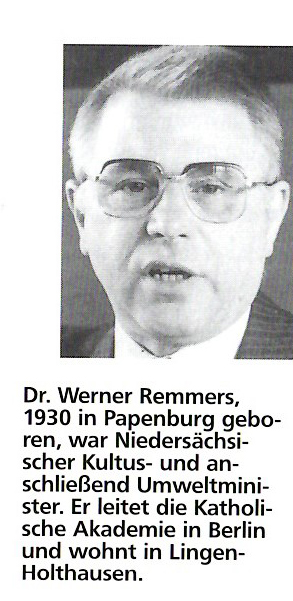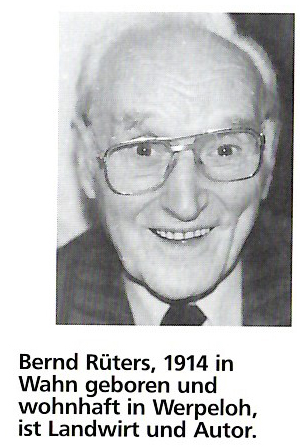„…häss du diene Föite nich wasket”
Im östlichen Teil des Landkreises Emsland, am Rande des Hahnenmoores, liegt das Dorf Dohren. Die kleine Gemeinde mit circa 1000 Einwohnern gehört zur Samtgemeinde Herzlake. Hier wurde ich am 2. November 1928 geboren. Aufgewachsen in einer Großfamilie, die von der Landwirtschaft lebte, lernte ich als erste Sprache unser Plattdeutsch.
Vor allem das unverfälschte Platt meiner Großmutter, die zu meiner Kinder- und Jugendzeit noch lebte, hat sich fest in mein Gedächtnis eingeprägt. An viele plattdeutsche Wörter, die heute aus dem Sprachgebrauch verschwunden sind, kann ich mich erinnern, wenn ich an diese Zeit zurückdenke.
Vor allem das unverfälschte Platt meiner Großmutter, die zu meiner Kinder- und Jugendzeit noch lebte, hat sich fest in mein Gedächtnis eingeprägt. An viele plattdeutsche Wörter, die heute aus dem Sprachgebrauch verschwunden sind, kann ich mich erinnern, wenn ich an diese Zeit zurückdenke.
Wenn ich im Vorschulalter ab und zu mit den Eltern in die Kirche ging, kam mir die hochdeutsche Predigt des Pfarrers fast so fremd vor wie das Latein der Messe. Als ich dann eingeschult wurde, war das Erlernen der hochdeutschen Sprache für mich und meine Mitschüler eine mühsame Arbeit. Von Vorteil war die Tatsache, daß die Lehrpersonen unseres Dorfes mit der plattdeutschen Sprache vertraut und damit die Schwierigkeiten einer gegenseitigen Verständigung relativ gering waren.
Die ersten Versuche, unser Platt ins Hochdeutsche umzuwandeln, müssen für unsere Lehrerin sehr interessant gewesen sein. Einige Sätze solchen Vokabulars blieben mir bis heute unvergeßlich. So erzählte zum Beispiel Nachbars Jööpken von einem aufregenden Erlebnis in der Bullenweide. Er schilderte dieses Abenteuer mit folgenden Worten: „Da raas der Bulle den Sticken aus und flog über die Frääen-ge.” Auf hochdeutsch: „ Da riss der Bullen den Pflock aus den Boden und sprang über die Einfriedung.” Ein anderer beklagte sich beim Sport auf dem Spielplatz: „Wenn ich nietzke laufen muß, werde ich immer schlecht.” Was heißen soll, daß ihm beim schnellen Laufen immer übel wird. Gewiß habe auch ich damals ähnliche Sätze formuliert, welche bei den Lehrpersonen viel Heiterkeit auslösten.
In den Familien ging man später dazu über, mit den Kindern hochdeutsch zu sprechen, in der Meinung, den Kindern damit zu helfen. Weil aber die Eltern selber Schwierigkeiten mit der hochdeutschen Sprache hatten, wurden dadurch die Lehrpersonen mehr be- als entlastet.
Leider reichlich spät hat der plattdeutsch sprechende Mensch erkannt, daß seine Muttersprache vom Aussterben bedroht ist. Ich erinnere mich, daß man als Plattdeutscher von Hemmungen geplagt und von Gleichaltrigen aus der Stadt als ungebildet und naiv betrachtet wurde. So wurde in fremder Gesellschaft von uns Dorfjungen darauf geachtet, ja nicht durch plattdeutsche Redensarten auffällig zu werden. Auch die Erwachsenen hatten im Umgang mit Leuten aus der Stadt ihre Schwierigkeiten. Besonders schwer war für die damalige Landbevölkerung ein Behördengang. Zum Glück gab es in unserer Kreisstadt Bedienstete von öffentlichen Ämtern, die durch ein einfaches plattdeutsches Wort die seelische Not der Bittsteller entschärften, wenn sie diese auf Plattdeutsch begrüßten.
deshalb besonders in typisch plattdeutschen Regionen, wie zum Beispiel im Ems-land, darauf bedacht sein, das hohe Kulturgut, die Muttersprache, zu pflegen und zu erhalten. Es ist lange her, daß das Plattdeutsche vom Hochdeutschen verdrängt wurde. Allein der historische Wert dieser Sprache rechtfertigt es, sich um ihren Erhalt zu bemühen. Menschen, die diese Sprache noch beherrschen, sollten dafür Sorge tragen, sie durch aktive Anwendung an die Nachkommen zu vermitteln. Das gesprochene Wort allein kann die Klangfarbe einer Sprache unverfälscht mitteilen. Eine Generation, die nicht nur plattdeutsch spricht, sondern auch noch plattdeutsch denkt, hat die Verpflichtung zu verhindern, daß der alte Wortschatz des Plattdeutschen endgültig verlorengeht.
Wir wissen heute, daß wir selber dazu beigetragen haben, den Wert unserer Muttersprache zu schmälern, weil wir uns schämten, wenn wir uns dabei ertappten, daß wir in der Öffentlichkeit platt sprachen. Dr. Fort, akademischer Oberrat und Leiter der Arbeitsstelle Friesisch/Ostfriesisch und Niederdeutsch im Bibliotheks-und Informationssystem der Universität Oldenburg, hat folgendes sehr treffend formuliert: „Protes du engelsk, büss du nen Gentleman. Protes du franzöösk, büss du nen Diplomat. Protes du platt, dann häss du diene Föite nich wasket.” So wurde der Plattdeutsche eingestuft, und es ging jahrelang bergab mit unserer Muttersprache, bis man sich eines Tages daran erinnerte, daß diese Sprache ein Stück Kulturgut ist. Daß es höchste Zeit wird, dieses schöne Erbe vor dem Vergessen und vor dem Untergang zu bewahren.
Wir sind die letzte Generation, die das Plattdeutsche von Kindesbeinen an spricht. Der echte Plattdeutsche hängt an seiner Muttersprache. Es ist ein Stück seiner selbst. Zum Glück gibt es Menschen, die darüber nachgedacht haben, um dann mit Hilfe von Heimatvereinen und ähnlichen Verbänden Initiativen zu entwickeln, das Schlimmste zu verhindern. Es ist erfreulich, daß auch in den Medien das Plattdeutsche wieder veröffentlicht und gefördert wird. Der beste Garant für die Erhaltung unseres plattdeutschen Sprachschatzes ist nach meiner Ansicht die Schule. Deshalb ist mit Genugtuung festzustellen, daß es in der heutigen Zeit möglich ist, den Plattdeutsch-Unterricht durch Lesewettbewerbe und ähnliches zu fördern. Es muß den Schülern klargemacht werden, daß das Plattdeutsche eine Sprache mit historischem Wert ist.
Die Erfahrung, daß Plattdeutsch auch völkerverbindend sein kann, machte ich persönlich im letzten Krieg als” Soldat in Holland. Unsere Einheit war eingeschlossen, und der Hunger war ein schlimmer Feind. An der Küste waren alle Zivilisten evakuiert, nur in den Städten gab es Zentralküchen für die Bevölkerung. Auf Plattdeutsch konnte ich mich sehr gut mit den Holländern verständlich machen. Meine Kameraden waren zum größten Teil Österreicher, die kein Wort von meiner Unterhaltung mit den Holländern verstanden. Sie staunten nur darüber, daß ich ab und zu mit einem gefüllten Kochgeschirr in die Stellung kam.
Die plattdeutsche Sprache wird wohl nie mehr Umgangssprache sein. Seinen Stellenwert behält das Plattdeutsche jedoch unter plattsprechenden Menschen, weil dadurch ein beglückendes Gefühl der Zusammengehörigkeit entsteht. Man sollte deshalb besonders in typisch plattdeutschen Regionen, wie zum Beispiel im Emsland, darauf bedacht sein, das hohe Kulturgut, die Muttersprache, zu pflegen und zu erhalten. Es ist lange her, daß das Plattdeutsche vom Hochdeutschen verdrängt wurde. Allein der historische Wert dieser Sprache rechtfertigt es, sich um ihren Erhalt zu bemühen. Menschen, die diese Sprache noch beherrschen, sollten dafür Sorge tragen, sie durch aktive Anwendung an die Nachkommen zu vermitteln. Das gesprochene Wort allein kann die Klangfarbe einer Sprache unverfälscht mitteilen. Eine Generation, die nicht nur plattdeutsch spricht, sondern auch noch plattdeutsch denkt, hat die Verpflichtung zu verhindern, daß der alte Wortschatz des Plattdeutschen endgültig verlorengeht.