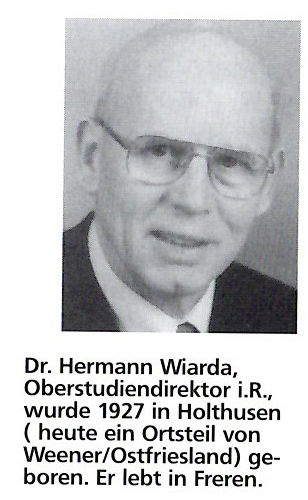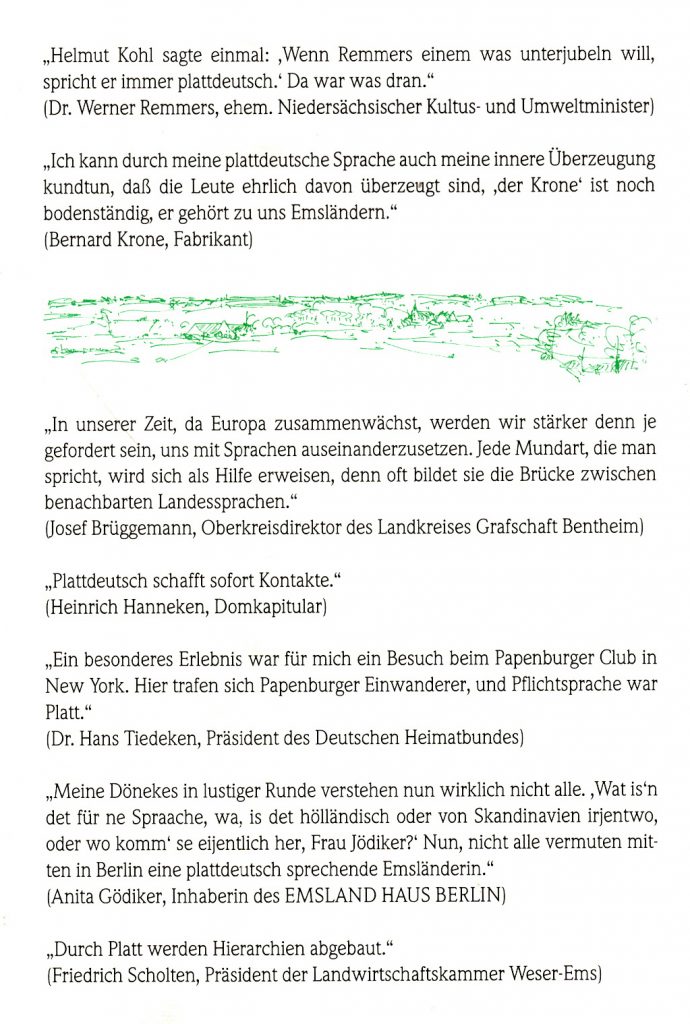Sogar in New York
Zunächst zu mir selbst. Wie komme ich dazu, mich zu diesem Thema zu äußern? Nun, zum einen, weil mich die Herausgeber dieses Buches darum gebeten haben. Aber das allein rechtfertigt noch nicht meine Mitarbeit. Zum anderen aber hängt es wohl damit zusammen, daß ich rund 20 Jahre Oberkreisdirektor im Emsland, dann 12 Jahre Hauptgeschäftsführer eines kommunalen Spitzenverbandes in Bonn gewesen bin und jetzt seit 16 Jahren Präsident des Deutschen Heimatbundes bin. Diese Tätigkeiten haben mir Einblicke in die soziale und kulturelle Bedeutung regionaler Lebens- und Sprachformen, gerade auch des Plattdeutschen, vermittelt. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Man kann die Bedeutung der Mundart – hier des Plattdeutschen – für die Erhaltung und Pflege einer regionalen Lebensform, zur Bewahrung regionaler Identität und Eigenart gar nicht hoch genug einschätzen. Wie komme ich aber zu dieser Einschätzung gerade in einer Zeit, wo Grenzen fallen oder abgebaut werden und alle Welt von Globalisierung, Maßstabsvergröße-rung und Vereinheitlichung spricht? Wie läßt sich das in Einklang bringen: auf der einen Seite größere Gebilde wie die Europäische Union, eine vernetzte, globale Welt mit der Weltsprache Englisch und auf der anderen Seite das Bekenntnis zur Erhaltung regionaler Lebensformen und Eigenheiten mit der plattdeutschen Mundart? Ist das nicht ein Widerspruch, der sich beim Blick über den regionalen Tellerrand von selbst auflöst?
Nein, dem ist nicht so. Größere Gebilde wie die Europäische Union oder eine vernetzte Welt brauchen überschaubare, sozial und kulturell gefestigte Räume. Sie brauchen Regionen, die bereit sind, sie mitzutragen. Regionale Bausteine wie das Emsland sind die Grundpfeiler 4m größeren System. Wenn sie funktionieren, eigenverantwortlich arbeiten und regionales Leben in Kultur, Sprache und Brauchtum entfalten, können sie das größere System tragen und sind auch dazu bereit. Diese föderale Ordnung hat unser Grundgesetz vorgegeben, sie hat sich bewährt und auf ein föderal gegliedertes Europa – das Europa der Regionen – hingeführt. Totalitäre Systeme haben sich – wie gerade die neuere Geschichte lehrt – nicht halten können. Sie haben die Regionalität mißachtet, regionale Lebensformen unterdrückt und sich damit ad absurdum geführt.
Das heutige Europa – die Europäische Union – erkennt regionale Lebensformen ausdrücklich an. Das haben die zuständigen Organe der EU durch die Verabschiedung der Charta der kommunalen Selbstverwaltung und der Charta der regionalen Selbstverwaltung – an denen ich für den Deutschen Landkreistag mitgearbeitet habe – deutlich gemacht. Und dazu zählen eigenständiger kultureller und sozialer Zuschnitt wie auch die Pflege eigenständiger Mundart.
Das war nicht für alle Mitglieder der EU mit zum Teil zentralistischen Vorstellungen von vornherein selbstverständlich. Aber das wurde durchgesetzt – mit deutlicher Aufwertung regionalen Denkens. Man kann sogar feststellen, daß politische und administrative Tendenzen zur Vereinheitlichung, zur zentralen Lenkung und globalen Handhabung – auf welcher Ebene auch immer – Gegenbewegungen, spürbare regionale Aktivitäten hervorgerufen haben, die wie ein Gegenstrom wirken und die Menschen in ihrer und für ihre Region beflügeln. Der Weg zur größeren Einheit hat gleichzeitig den Zug zur Entfaltung regionaler Lebensformen, zur Bewahrung regionaler Identität und Eigenart, gerade auch auf dem Gebiet von Brauchtum und Mundart, herausgefordert und gefördert.
Das gilt auch für das Plattdeutsch im Emsland.
Ich bin mit der plattdeutschen Mundart als Papenburger von Kind an in Berührung gekommen, beim Spielen und auch in der Schule (allerdings auf dem Schulhof). Zu Hause sprachen wir zwar hochdeutsch, aber im Geschäft meines Vaters sprach die Kundschaft oftmals platt, und dadurch lernte ich es auch. Seinerzeit wurde die plattdeutsche Sprache (leider!) „etwas tief” angesiedelt; man sprach hochdeutsch!
Aber als ich nach Kriegszeit und Ausbildung in den 50er Jahren wieder beruflich ins Emsland zurückkehrte, nahm der Stellenwert des Plattdeutschen zu. Für mich war das Platt auch wichtig; denn die Bürgermeister und Gemeindevertreter der damals noch 53 Gemeinden im Landkreis Aschendorf-Hümmling und zuvor im Kreise Meppen sprachen, abgesehen von den Städten, gern platt. Man kam besser über das Plattdeutsch an das Anliegen seiner Gesprächspartner heran, und man kam sich auch viel näher. In ihrer Heimatsprache fühlten sich die Bürgermeister und Gemeindevertreter sicherer, und manches läßt sich auch im Plattdeutschen viel besser und vor allem treffender ausdrücken. Das Plattdeutsch ist plastischer und griffiger.
Ohne Plattdeutsch hätte ich manches gar nicht erfahren und wäre damit ein schlecht unterrichteter Oberkreisdirektor gewesen. Mir persönlich hat es manchen Zugang erleichtert. Für kommunale Vertreter im Emsland ist die Kenntnis des Plattdeutschen ein großer Vorteil, ich würde fast sagen (leicht überspitzt!) Einstellungsvoraussetzung!
In meiner Bonner Zeit war das Plattdeutsch nicht so gefragt – abgesehen von besonderen Veranstaltungen in der Niedersächsischen Landesvertretung, vor allem in der Zeit, wo Minister Hasselmann der Bonner Vertretung vorstand, oder wenn Minister Werner Remmers dort auftrat; dann wurde „platt gekürt”.
Ein besonderes Erlebnis war für mich mein Besuch Ende der 60er Jahre beim Pa-penburger Club in New York. Hier trafen sich am ersten Montagabend in jedem Monat Papenburger Einwanderer, und Pflichtsprache war Papenburger Platt. Auch Hermann Lenger, der 1925 ausgewandert war und den ich damals besuchte, sprach mit mir bei sich zu Hause platt. Leider gibt es heute diesen Papenburger Club nicht mehr; die nachwachsende Generation hat die Verbindung zur Heimat und Heimatsprache leider nicht mehr so gepflegt.
Im Deutschen Heimatbund haben wir eine eigene Fachgruppe für Brauchtum und Mundart ins Leben gerufen, die zusammen mit unseren 18 Landesverbänden und ihren Vertretern intensiv arbeitet und sich um die Erfassung und Erhaltung von Brauchtum, Trachten und Heimatsprache kümmert. Gleiches gilt für den Niedersächsischen Heimatbund. Man sieht also, daß der Rahmen in Europa und in unserem Lande gesteckt worden ist. Es gilt, ihn auszufüllen. Im Emsland und besonders beim Emsländischen Heimatbund sind dafür gute Voraussetzungen gegeben. Zunehmende Aktivitäten belegen: „Man kürt gern platt!”