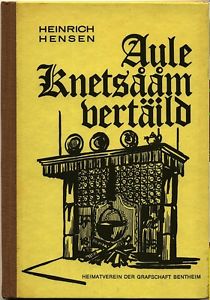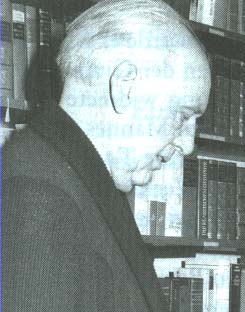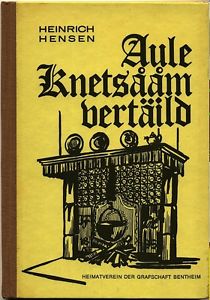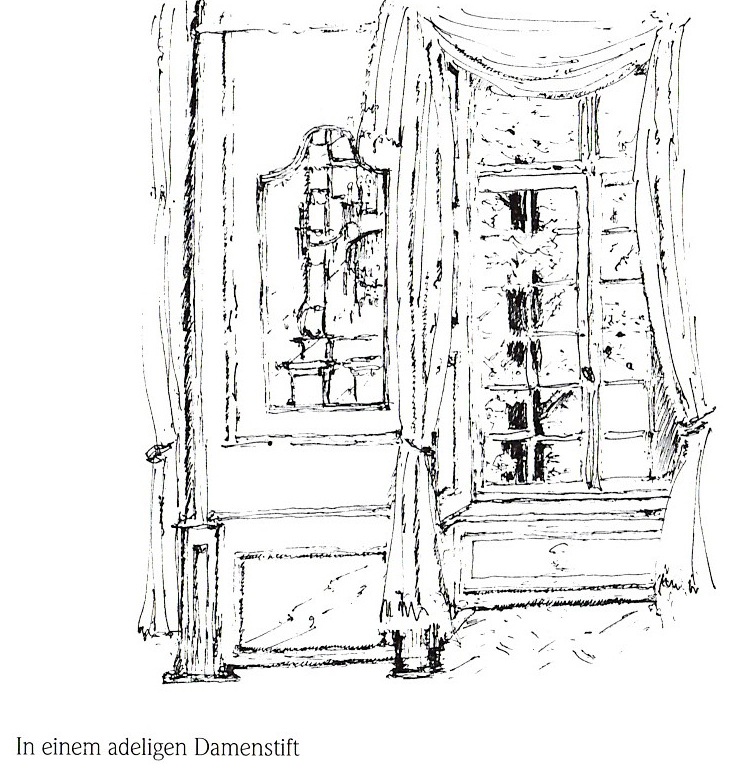- Wu is datt mit use Platt?
- Watt up Platt!
- Watt över Platt…
Derzeitiger Stand:
Dieser Versuch einer Dokumentation des Schwundes der plattdeutschen Sprache entwickelt sich weiterhin erfreulich und hat mittlerweile einen Umfang von etwa 380 Seiten angenommen.
Deshalb wird dieses Vorhaben nun endgültig zum 1. Mai 2918 online gestellt werden und sich dann „veröffentlicht“ weiter entwickeln.
Ausgangslage:
Zunächst bildeten zwei Grundthemen das Gerüst:
- sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum jeweiligen Stand der abnehmenden Plattdeutschkompetenz (Schwerpunkt: zehnjährige Kinder im LK Borken und im LK Emsland)
- die Fortführung des Buchprojekts Wat, de kann Platt auf Website – Art, interessante Grafschafter und Emsländer erneut zu befragen mit dem Betrachtungszeitraum der letzten 20 Jahre.
Daraus ist mittlerweile räumlich und thematisch viel mehr geworden.
Dabei kann ich als besonderen Vorteil nutzen, dass Dr. Helmut Lensing und ich uns durch unsere Veröffentlichungen zum Heuerlingswesen im gesamten deutschen Nordwesten Bekanntheit und Ansehen erwerben konnten.
Allein durch meine über 120 Vorträge habe ich viele engagierte Heimatforscher und insbesondere Plattdeutschkenner, aber auch Autoren und Autorinnen kennengelernt und ich stehe mit Ihnen in Kontakt.
Somit erweiterte sich das Betrachtungsgebiet enorm.
Bisherige Erfahrungen:
Es liegen mittlerweile einige schriftliche Rückmeldungen vor, die auch schon eingestellt sind. So konnten zusammen mit Dr. Bernard Krone und Franz Rothkötter hochinteressante Firmenportraits up platt entwickelt werden.
Auch die Interviews mit den beiden polyglotten Theologen Alfons Strodt (Osnabrück) und Dr. Heiner Wilmer (noch Rom, bald Bischof in Hildesheim) haben ganz besondere Erkenntnisse erbracht.
Dem früheren Landrat des Emslandes (jetzt Präsident der Emsländischen Landschaft u. a.), Hermann Bröring, hat das Video – Interview nach eigenen Angaben Freude bereitet, man kann es beim Betrachten der Kurzfilme regelrecht verspüren…
Allerdings sind die Aufnahmen in dieser Art für mich in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sehr zeitaufwändig.
Erheblich einfacher sind da vorbereitete Telefoninterviews, die dann mit Fotos aus dem Leben und Arbeiten der Interviewten ebenfalls zu einem abwechslungsreichen und interessanten Video gemacht werden können.
Was kann und was sollte nun weiterer passieren?
- Vorrangig ist sicherlich die Fortsetzung der Vorstellung von weiteren Zeitzeugen/innen auf Platt, denn das gesprochene Wort hat in dieser Sprache einen ganz besonderen Stellenwert, da die Schriftsprache in den einzelnen Regionen auf verschiedenen Ebenen zu unterschiedlich ist.
- Damit entstehen gleichzeitig authentische Sprecherbeispiele von „Plattkönnern“ aus den verschieden Regionen, die für die zukünftigen – wohl plattärmeren – Zeiten in mehrfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung sein können.
- Es sollen weitere Initiativen vorgestellt werden z.B. Möglichkeiten der Demenzbegleitung
- Durch Besuche von Schulen (Hamburg, Schleswig-Holstein), die Plattdeutsch in den Fächerkanon aufgenommen haben, können neue Erkenntnisse zusammengetragen werden: Was ist schon gelungen, was kann überhaupt gelingen – eine kritische Bestandsaufnahme.
Zusammengefasst…
Hier entsteht etwas Neues.
Dabei ist es völlig selbstverständlich, dass ein solches Unterfangen mit Neugier, aber auch mit entsprechender Skepsis oder auch in Ablehnung aufgenommen wird.
Im Gegensatz zu einem Buch in seiner festen Struktur sollen sich hier ständig neue Inhalte zunächst aneinander reihen, um dann doch zu einem möglichst in sich geschlossenen Ganzen zu werden mit den Oberthemen
- Versuch einer Dokumentation des Schwundes der niederdeutschen Sprache und
- Auffinden und mögliche Stärkung solcher Orte, an denen die plattdeutsche Sprache lebendig ist.
Dabei sollte es zunehmend gelingen, die unterschiedlichen „Qualitäten“ der Informationen halbwegs kompatibel und damit auch für den kritischen Besucher akzeptabel zu gestalten
Der vornehmliche Adressat soll ja der interessierte Laie sein, für den ein spezielles Forum geschaffen werden soll, das ihm die Möglichkeit gibt, sich auch nach den teilweise recht kurz kommentierten (bzw. nur zitierten) Links umfassender im Web zum Gesamtthema zu informieren.
Meine Erfahrungen mit der Website www.heuerleute.de, die mittlerweile über 900 Seiten umfasst, ermutigen mich aber. Zunehmend finde ich aktive Mitstreiter – im wahrsten Sinne des Wortes.
Besonders erfreulich ist es, dass gerade jüngere Fachwissenschaftler zu einer zielführenden Zusammenarbeit bereit sind. Das habe ich gerade im letzten Jahr bei der Konzeption des Buches Heuerhäuser im Wandel erlebt, als einige namhafte Fachleute spontan bereit waren, einen Aufsatz einzubringen.
Dahinter steht auch wohl die zunehmende – nüchterne – Erkenntnis, dass sprachwissenschaftliche, historische und volkskundliche Fachveröffentlichungen in der Regel nur von allenfalls 40 bis 70 Insidern komplett gelesen werden.
Mehrfach wurde mir versichert, dass dort der Wunsch besteht, sich einem breiteren Publikum zu öffnen.
Nun kann sich hier die Möglichkeit bieten, dass ein Brückenschlag zwischen Fachwissenschaftlern und interessierten Laien gelingt.
Prof. Dr. Ludger Kremer stellt seinen jüngsten Aufsatz Sprachwandel und Sprachwechselim deutsch-niederländischen Grenzland auch dieser Website per Link zur Verfügung.
Einen besonderen Stellenwert in diesem Kontext haben sicherlich auch die kompakten Ausführungen von Alfred Möllers, der als früherer Regierungsschuldirektor im Osnabrücker Land sehr engagiert und erfolgreich eine agile Schar von plattsprechenden Lehrpersonen um sich sammeln konnte. Es wurden umfangreiche Unterrichtsmaterialien erstellt und den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Hier haben auch andere Regionen Anregungen erhalten. Seine nüchterne und klare Bilanz zur heutigen Situation auf dieser Website sollte von jedem Plattdeutsch – Euphoriker mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen werden.
Darüber hinaus stellt auch Prof. Dr. med. Gerhard Pott aus Nordhorn seine sehr passenden Federzeichnungen mit Motiven aus der Regionen zur Verfügung.
In einer anlaufende Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück – Fakultät Management, Kultur und Technik – möchte ich das Ziel verfolgen, möglichst unkomplizierte Materialien zur Demenzbegleitung zu entwickeln. Da ich durch meine vier Bände zur FotoSprache
http://www.watt-up-platt.de/demenzbuch-ja-so-war-das-damals-1/
schon einige Erfahrungen auf diesem Spezialgebiet sammeln konnte, bin ich nun dabei, neue technische Möglichkeiten zu nutzen, die plattdeutsche Sprache mit älteren Schwarzweißfotos aus dem kindlichen Erfahrungsbereich der Erkrankten zu kombinieren und dazu verschiedene Themenbereiche entsprechend zu gestalten. Dabei wird es allerdings nötig sein, entsprechende regionale Ausgaben zu schaffen, da gerade dieser Patientenkreis sehr empfindlich auf „verkehrtes Platt“ reagiert – nur die eigene Variante wird akzeptiert.
Meine Kontakte in alle Teilregionen Nordwestdeutschlands machen dort eine gezielte Zusammenarbeit mit Fachleuten jeweils vor Ort unkompliziert möglich.
Selbst wenn man die mögliche Ausgestaltung der neu entstandenen Ministerien für Heimat im Bund und Land nur erahnen kann, die Sprache sollte dort einen Stellenwert haben, denn sie ist ohne Zweifel das höchste Kulturgut des Menschen.
Hinweis zum möglichen Umgang mit dieser Website:
Im Menüpunkt Aktuelles sollen mehrmals in der Woche neue Beiträge eingestellt werden.