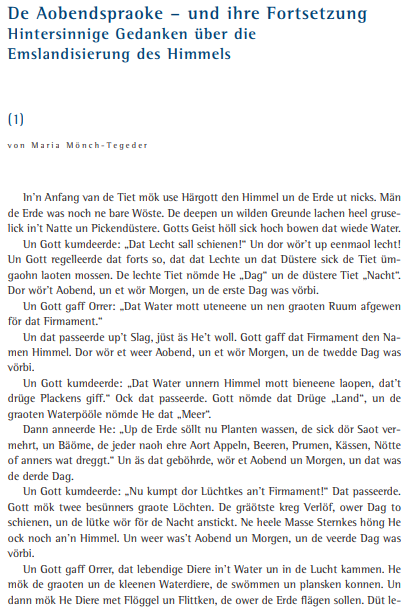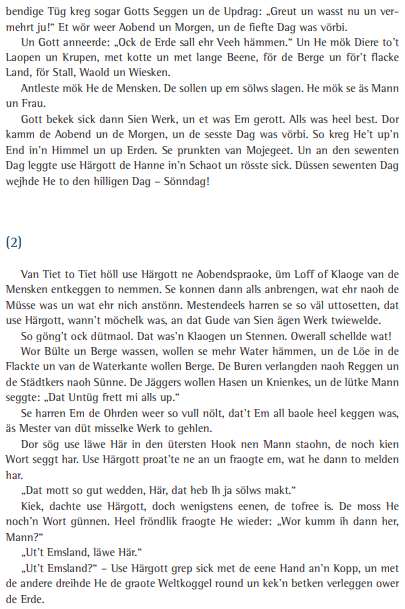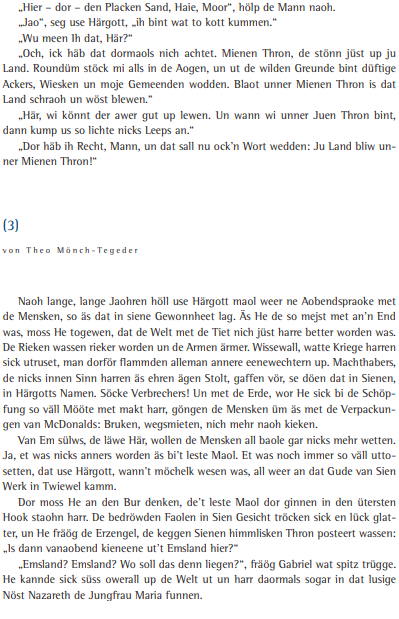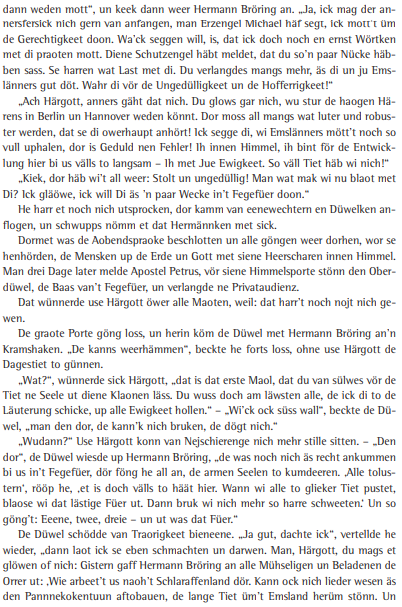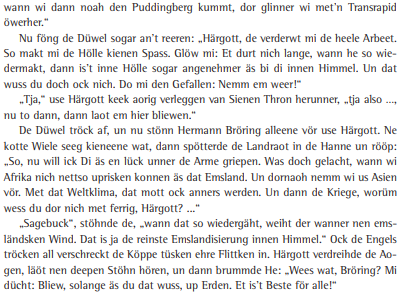Land der Neidhammel?
Aufgewachsen im Emsland, war für mich bis zur Einschulung in einer kleinen zweiklassigen Volksschule Plattdeutsch die einzige Sprache. Dies verursachte bei mir später auf dem Gymnasium einige Schwierigkeiten in Deutsch, hat aber dennoch meinem beruflichen Werdegang keine erkennbaren Nachteile gebracht.
Als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens ist es heute für mich mehr als natürlich, mit den unterschiedlichsten Personen zusammenzutreffen, zumal ich vorwiegend international tätig bin. Weniger vermuten läßt sich, daß man selbst im außereuropäischen Ausland immer wieder mit der plattdeutschen Sprache konfrontiert wird. So sprechen nord- oder südamerikanische Geschäftspartner gern über aktuelle oder frühere familiäre Verbindungen nach Europa. Kaum ein Geschäftspartner in den USA, der nicht bei einem seiner Vorfahren Verbindungen zu Deutschland nachweisen kann. Anders war dagegen die Situation nach der „Wende”, der Wiedervereinigung in Deutschland. Noch über ein Jahr nach dem Fall der Mauer beherrschten die Fragen nach der hieraus resultierenden volkswirtschaftlichen Bürde die Diskussionen.
Beim abendlichen Empfang anläßlich eines jährlichen Fach-Symposiums in Hou-ston/Texas mit zahlreichen internationalen Gästen vor allem aus dem Bereich der Wirtschaft wurde ich wieder einmal über Deutschland und insbesondere die wirtschaftliche Situation aufgrund der Wende befragt. Weniger war der europäische Zusammenschluß von Interesse, auch wenn ich mich seinerzeit persönlich gern als Europäer sah. Niemals habe ich Äußerungen von der Art vernommen, daß Deutschland zu sehr erstarke. Dagegen herrschte speziell bei den US-amerikanischen Geschäftspartnern große Sorge, daß wir Deutschen die finanzielle Bürde nicht verkraften könnten — bis hin zu den möglichen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.
Da ich selber die globalen Zusammenhänge nicht genügend verstand, habe ich mich gern auf die bekannten deutschen Tugenden wie Wirtschaftsstärke, Fleiß, Kreativität, Belastbarkeit, guter Ausbildungsstand der Facharbeiter etc. berufen. Ich vertrat die Überzeugung, daß diese ausreichen sollten, um *die Hinterlassenschaft der DDR innerhalb eines Jahrzehnts weitgehend zu absorbieren beziehungsweise zu kompensieren. Meine Äußerungen wurden in der Regel wohlwollend aufgenommen, aber die deutsche Finanzkraft doch zum Teil mit Skepsis bedacht.
Später an jenem Abend — viele Gäste hatten den Empfang schon verlassen — stellte sich mir ein älterer Herr namens John in fast akzentfreiem Deutsch vor. Auf meine Frage, woher er die guten Deutschkenntnisse habe, ob er gar ursprünglich Deutscher sei, erwähnte John nur, daß er meinen Ausführungen gern zugehört habe. Er könne sie aber nicht voll bestätigen, sondern wolle meinen Ansichten über die typisch deutschen Tugenden gern einiges hinzufügen, was womöglich nicht ganz so positiv sei. Für eine größere Gesprächsrunde seien seine Einwendungen jedoch nicht so passend gewesen, meinte John.
Dann erzählte er mir, daß er seine Kenntnisse der deutschen Sprache sowie über Land und Leute als Soldat im Laufe von drei Jahren in der Nachkriegszeit in Norddeutschland erworben habe. Und später brachte er im Rahmen einer Forschungsarbeit des Lehrstuhls für Soziologie (social sciences) der dortigen Universität eine zweite Zeit wiederum vorwiegend in Norddeutschland zu.
Im Rahmen dieses Projektes sollten die möglichen Auswirkungen einer zunehmenden Bevölkerungsdichte Europas außerhalb der Ballungszentren untersucht werden, um auf Basis der nahezu zweitausendjährigen europäischen Erfahrung Rückschlüsse für die amerikanische Entwicklung zu ziehen. In Spanien, Frankreich, Holland, Italien und Deutschland wurde jeweils auch die aktuelle Situation durch Beobachtungen vor Ort analysiert. Aufgrund seiner guten Deutschkenntnisse hatte John sich für Deutschland entschieden.
Nun fragte er mich, welche weniger positiven Seiten der Deutschen ich denn sehe. Prompt antwortete ich mit Obrigkeitsdenken und Verbissenheit. Letzteres wollte Lohn jedoch nicht bestätigen, nannte aber eine andere, in seiner Sicht typisch deutsche Eigenart: den Neid, insbesondere den mißgünstigen Sozialneid. Wie sonst sei der Drang der Deutschen nach „Gleichheit vor individueller Freiheit” zu erklären, fragte er. Dadurch würden doch viele gute Ansätze im privaten, im beruflichen wie auch im geschäftlichen Bereich schon im Keim erstickt. Wer etwas Besonderes leisten wolle, werde stark behindert. Für ihn stellte es sich so dar, daß der Erfolg des anderen für viele ein Spiegel ist, in dem sie ihr eigenes Unvermögen erkennen. Dieser werde damit zum Objekt des Zerstörenwollens, weniger hingegen zum Maßstab für eigene Zielsetzungen. Wer in Deutschland etwas unternehmen wolle, werde doch durch das allgemeine Neidklima eingeschüchtert und abgeschreckt.
Ich war sehr betroffen. Sind wir etwa das Land der Neider? Nach einigem Nachdenken erwiderte ich, daß ich eine Begründung nur in der hohen Bevölkerungsdichte sehen könne. Er erwiderte, daß auch seine Arbeitsgruppe sehr überrascht gewesen sei von der ungewöhnlich hohen Neidbereitschaft der deutschen Bevölkerung im Vergleich zu den anderen untersuchten europäischen Staaten, zumal die Neidbereitschaft in Nordamerika so gut wie unbekannt sei. Das Phänomen sei jedoch offensichtlich nicht allein auf die relativ hohe Bevölkerungsdichte in Deutschland zurückzuführen, da diese in anderen untersüchten Gebieten vergleichbar sei. Er meinte dagegen: „Wo jedermann von der Wiege bis zur Bahre bedenkenlos ermuntert wird, seine Rechte vom Kindergartenplatz bis zur Vollbetreuung im Rentenalter einzuklagen, gingen wohl offensichtlich viele Maßstäbe verloren.” Die Antwort sind wir uns letztlich schuldig geblieben.
John erzählte weiter, daß er sich seinerzeit bei seinen Untersuchungen vornehmlich für die ländlich strukturierten Gegenden und kleineren Städte interessiert habe. So habe er einige Abende in ländlichen Gaststätten zugebracht und versucht, sich auch mit der plattdeutschen Sprache auseinanderzusetzen. Der Erfolg sei jedoch mäßig geblieben trotz seiner befriedigenden Deutschkenntnisse. Ich habe daraufhin versucht, eine plattdeutsche Konversation mit ihm aufzubauen, doch dieses Unterfangen wurde sehr hölzern. Er entschuldigte sich und berichtete von einer amerikanischen Gruppe aus dem Gebiet West Virginia, die die plattdeutsche Sprache pflege, da ihre Vorfahren, meist Bauern und kleine Handwerker, nach der Auswanderung die Heimatsprache zum Teil beibehalten hätten.
Am nächsten Tag rief er mich im Hotel an, um mir die Telefonnummer eines Ansprechpartners dieser Gruppe mitzuteilen. Würde ich je in diese Gegend kommen, solle ich doch bitte Kontakt aufnehmen. Man werde sich sicherlich sehr freuen. Leider ist es dazu bisher nicht gekommen.
Zum Schluß unserer sozialkritischen, leicht philosophischen Diskussion verabschiedete sich John und versuchte sich nochmals in Plattdeutsch: „Houl die munter”, worauf ich erwiderte: „See you next time in Germany, the contry of Neidhammels, having a glass of good tasting German Pils together.”
aus: Wat, de kann Platt, a.o.O. Seite 116 -118