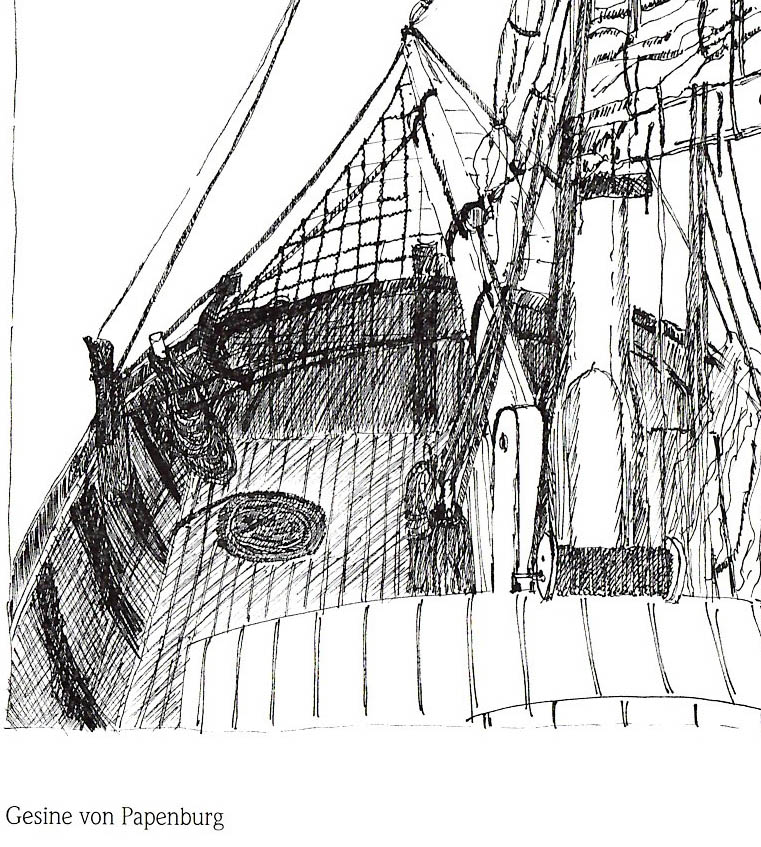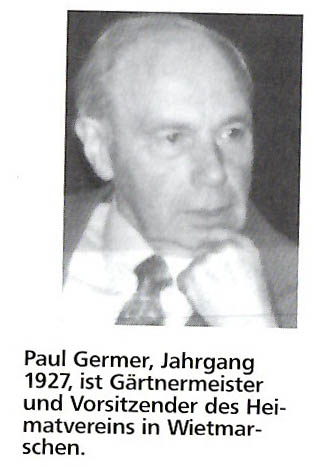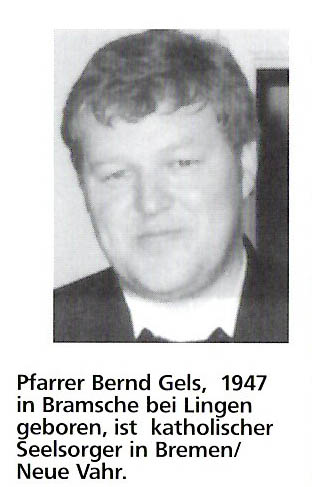Heraus aus dem Dornröschenschlaf!
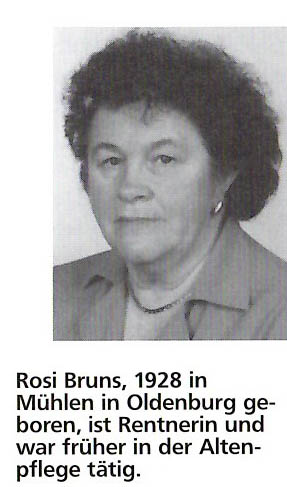
1928 in Mühlen in Oldenburg geboren, wuchs ich ländlich mit 9 Geschwistern auf. Meine Eltern besaßen einen kleinen Bauernhof. Überall wurde Platt gesprochen, war für uns als Erstsprache selbstverständlich. Ich habe zu keiner Zeit die Sprache als Last empfunden. Die Eltern beherrschten die hochdeutsche Sprache natürlich gut. An unser Ohr drang sie jedoch kaum. Für mich ist es noch heute unglaublich, wie schnell wir mit dem Einschulalter dann hochdeutsch sprechen und schreiben lernten. Unsere Lehrpersonen versuchten oft aus Spaß, bruchstückhaft mit uns Platt zu sprechen. Wir durften dann korrigieren.
Besonders heute weiß ich um die Vorzüge der plattdeutschen Sprache. Sie birgt eine einfache Herzlichkeit in sich, die für das Zusammenleben sehr förderlich ist. Die Naturverbundenheit mit dem lebendigsten Erleben bringt diese Sprache auf den Punkt. Auf dem Schoße der Großeltern erlernten wir Kinder alle möglichen Tierstimmen – lustige Verse, fast auf jedes Tier einen gemünzt. Plattdeutsche Gedichte, Lieder, Dönkes hat man sich, weil es so interessant klang, schnell gemerkt. Geist und Seele konnten sich entfalten.
Das Erleben auf dem Bauernhof sehe ich in dieser Richtung sehr positiv. Wir wurden früh spielerisch und hilfsbereit an kleine Pflichten herangeführt. Das half, früh soziale Kontakte aufzubauen – ein Ansporn für Kreativität. Viele alte Sprichwörter und Bauernregeln bestätigen die sozialen und moralischen Grundsätze. So wurde uns Kindern die spätere Lebenswirklichkeit früh nahegebracht. Ganz selbstverständlich wuchsen wir mit christlichen Sitten und Gebräuchen auf. Diese waren in der plattdeutsch sprechenden Gegend nicht wegzudenken. Dabei war der kleine Wortschatz von Kindern schon von Nutzen und stützte das Bedürfnis der Anerkennung. Noch zu erwähnen sind die alten, nett klingenden Doppelnamen.
Was bei aller Gemütlichkeit auf Platt an Komik überbracht werden kann, ist auf Hochdeutsch gar nicht so locker hinzukriegen. Ein wahrhaft goldener Humor bei aller Realität! Auch derbe Wörter klingen nicht so verletzend. Das Miteinander läßt so leicht keinen Platz für Frust und schlechte Laune. Auch wenn die Welt vor Neuheiten und Techniken fast aus den Fugen gerät, lohnt es sich bestimmt, unser Kulturgut noch wieder aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Nette Menschen älteren Semesters sind sicher gerne bereit, beim Erhalt der plattdeutschen Sprache mitzuwirken. Öfter müßten in Plattdeutsch besprochene Kassetten angeboten werden!
In den Schulen könnte es vielleicht sogar zum Pflichtfach gemacht werden; vielleicht nur einige Stunden im Monat, um sich so der jeweiligen Gegend entsprechend wieder mit dem Plattdeutschen vertraut zu machen. Schön wäre, es gäbe neue Ansätze, gute altbewährte Sitten und Gebräuche – bei aller Herausforderung der Zeit – wieder mehr mit einzubinden. Oft in fröhlicher Gemeinschaft plattsprechende Persönlichkeiten zu Wort kommen lassen, so unseren Nachwuchs für den wertvollen Kulturschatz zu erobern, das wäre der schönste Lohn für alle, denen der Erhalt der plattdeutschen Sprache am Herzen liegt.