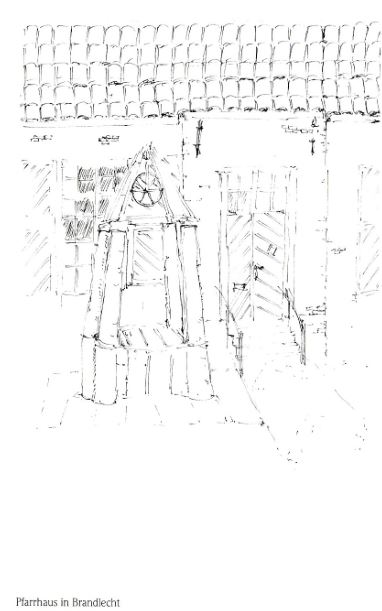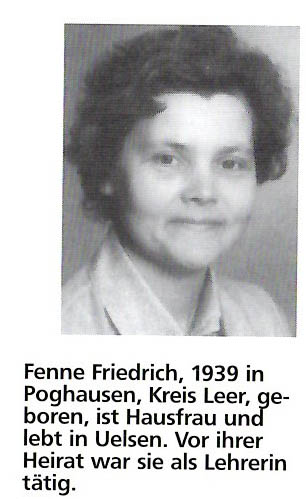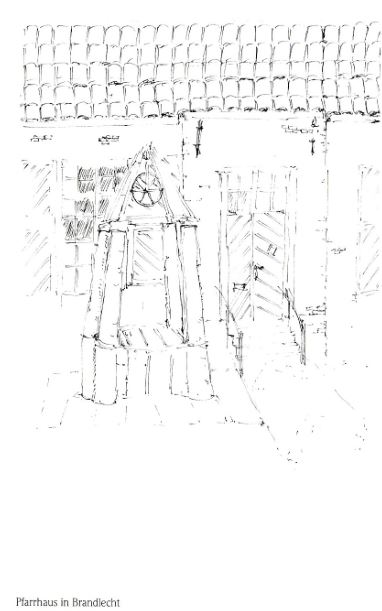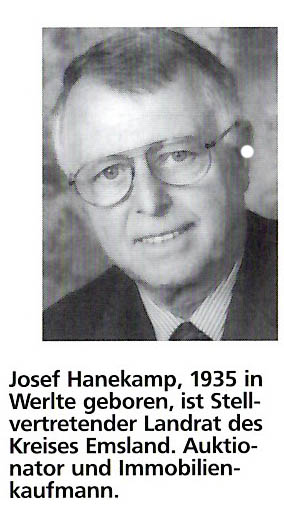Begegnung auf dem Meppener Markt
Textbeitrag in Wat, de kann Platt aus dem Jahre 1998

Die „plattdeutsche” Woche hatte es in sich gehabt
Da hatten die Texte für das nächste Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes zur Bearbeitung angestanden: Die Durchgängigkeit der Schreibweise war zu überprüfen gewesen, über eine plausible Anwendung des Apostrophs hatte man sich schlüssig werden müssen; die Interpunktion – ein Stiefkind so manchen plattdeutschen Autors – war zu modifizieren gewesen. Zu allem Überfluß waren wir von der Schriftleitung nicht umhin gekommen, einen Autor auf das übernächste Jahrbuch zu vertrösten, einen weiteren Lyriker um eine Überarbeitung seines Gedichtes zu bitten, und einem dritten Plattdeutsch-Schreiber schließlich hatte man eine höfliche, aber bestimmte Absage zukommen lassen müssen. Ein leidiges, immer wiederkehrendes Problem erübrigte jegliche Diskussion über einen in Frage kommenden Abdruck: Ein Text hat noch lange keinen literarischen Wert, nur weil er auf Plattdeutsch geschrieben ist.
Zudem hatte die Woche einmal mehr gezeigt, daß niederdeutsche Autoren zum Teil ausgesprochen empfindliche Individualisten sind. Werkkritik zu üben ist eine schöne Sache, sie jedoch einstecken zu müssen, löst alles andere als Begeisterung aus, provoziert rasch harsche Reaktionen.
Am Ende der Arbeitswoche: Seele baumeln lassen auf dem alten Meppener Markt, Kaffee trinken in Sichtweite des Rathauses, Wahrzeichen dieser lange Zeit kleinen, halt ackerbürgerlichen, aber alten und auch selbstbewußten Stadt.
Das Sinnieren über die Begegnungen mit der plattdeutschen Sprache im Verlauf des letzten Jahrzehnts macht Halt bei so manchem Erlebnis der besonderen Art; einem wohlgemeinten und an sich auch durchaus erfolgreichen Plattdeutsch-Festival beispielsweise, das vor einer Reihe von Jahren in der emsländischen Kreisstadt durchgeführt wurde. Die vom Ausrichter beauftragte „Full-Service-Agentur” aus Hannover und die Projektleiterin – sinnigerweise eine Neuseeländerin – hatten im Vorfeld dieses Autorenwettbewerbes einen enormen Wirbel veranstaltet. Plakate hingen aus, Handzettel und Aufkleber wurden verteilt, die Presse berichtete „headline”. Nur an eines hatte man nicht gedacht: Die Zahl der von den einzelnen Teilnehmern einzusendenden Geschichten zu begrenzen. Die Folgen waren kräftezehrend: Tagelang, ja ein ganzes Wochenende im Harz, hatte ich als Jurymitglied damit zugebracht, plattdeutsche Texte, darunter gute Literatur, aber auch umständlich erzählte Dönkes und zahllose Gelegenheitsgedichte, zu lesen.
Die unerfreulichen Auseinandersetzungen bei der Gründung eines Autorenkreises gehen mir durch den Kopf. Die dabei zu Tage getretene Intoleranz gegenüber Plattdeutsch-Schreibern aus einer Nachbarregion war erschreckend gewesen. Die immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen um das „richtige” Platt, die „richtige” Schreibweise hatten ermüdend gewirkt.
Schließlich gab es auch im Bereich des Niederdeutschen den im kulturellen Leben heute alltäglichen Vorgang der Ausgrenzung nach dem Motto „WIR – will heißen ICH – besetze(n) das Thema”. Kompetenz: zweitrangig; Konzeption: interessiert nicht; kultureller Alleinvertretungsanspruch: Maß aller Dinge!
Sicherlich, es gab auch die schlichtweg erfreulichen Ansätze: den Ruck, der durch die Schulen gegangen war, als das plattdeutsche Lesebuch vom Landkreis veröffentlicht und verteilt wurde. Auch die Qualität etlicher emsländischer Autorinnen und Autoren hatte sich enorm entwickelt. Zu Recht erfreute sich so mancher emsländische Schriever mittlerweile der Anerkennung in überregionalen Vereinigungen wie dem Schrieverkring und kam auf diesem rutschigen Terrain gut zurecht. Mit der unvergessenen Maria Mönch-Tegeder war die Kette lesenswerter plattdeutscher Schreiber nicht endgültig abgerissen. Bücher wurden in den letzten Jahren wieder gedruckt, zum Teil sogar geschmackvoll gestaltet, danach gekonnt und mit der nötigen Sorgfalt hergestellt – Bücher, die man gern zur Hand nimmt.
Namentlich in Meppen, aber auch andernorts – beispielsweise in Thuine – waren in den letzten Jahren Musikgruppen entstanden, die – unerwartet – Furore machten, mit ihren neuen, teilweise selbst getexteten und komponierten Liedern begeisterten, mühelos Säle wie den Kossehof füllten.
Und auch in der niederdeutschen Theaterszene tat sich einiges: Niederdeutsche Theatergruppen zeigten einfach besseres Theater, spürten in zunehmendem Maße ihre Bedeutung für das kulturelle Leben im Dorf. Ihre Ankündigungen, ihre Jubiläumsfeiern waren Spiegelbild gewachsenen Selbstbewußtseins. Ein niederdeutscher Theaterwettbewerb war Initialzündung für zwei bemerkenswerte neue Inszenierungen: „Liek moket” und „Der Bettelpfarrer”. Von einer Hümmlingerin geschrieben und von einer engagierten Theatergruppe auf die Bühne gebracht, hatte das Stück unter der Regie eines jungen Theatermachers des Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen Landschaft viele Besucher von Lingen bis Papenburg beeindruckt und Betroffenheit ausgelöst. Auch die Begeisterung namentlich junger Menschen auf einem plattdeutschen Wochenende in der Nordhorner Kornmühle war mir in allerbester Erinnerung geblieben.
Trotzdem, die Förderung der plattdeutschen Sprache hatte sich im Laufe der Jahre als ein schwieriges Feld erwiesen, mit vielen Komplikationen und der immer wiederkehrenden Frage: „Lohnt sich das Ganze noch, wo doch kaum noch Kinder und Jugendliche bei uns zu finden sind, die zweisprachig, also hochdeutsch und niederdeutsch aufwachsen. Und außerdem: Ist der Aufwand vertretbar angesichts der enormen Dynamik in den Bevölkerungs- und Sozialstrukturen des Emslandes, der zunehmend problematischer werdenden Lage wachsender Randgruppen und der Tatsache, daß das Emsland mit dem unabweisbaren ökonomischen Modernisierungsdruck auch die typischen gesellschaftlichen Modernisierungslasten erfährt?”
Die Stimme, die ich von einem Nachbartisch plötzlich höre, kommt mir bekannt vor, kenne ich doch aus längst vergangenen Tagen in Freren, von gemeinsamen Zeiten im Kindergarten an der Goldstraße, Jahren in der Franziskus-Demann-Schule. Wir hatten zusammen gespielt auf dem Bauernhof seiner Eltern auf dem Lünsfeld, später gemeinsam eine katholische Jugendgruppe geleitet, unvergessene Feten zusammen gefeiert und waren in jugendlichem Enthusiasmus gemeinsam und nachhaltig in ein paar Fettnäpfchen des nach unserer Meinung allzu behäbigen Städtchens getreten. Dann, in Studienzeiten, waren noch gelegentlich Besuche vorgekommen, schließlich hatten wir uns aus den Augen verloren. Er war Lehrer geworden an einer berufsbildenden Schule in Ostfriesland. Ein engagierter Pädagoge, der über die Schule hinaus sich als langjähriger Leiter des Arbeitskreises „Regionalentwicklung” im Regionalen Pädagogischen Zentrum der Ostfriesischen Landschaft einen Namen gemacht hatte. 1996 war ihm für dieses Engagement der „Upstalsboom-Taler” verliehen worden.
Ein zwangloses, aber intensives Gespräch folgt. Es gibt viel zu erzählen, Privates und Berufliches, von Interessen und Projekten, aus Ostfriesland und dem Emsland. Ein Gespräch in unserer Sprache: Plattdeutsch. Wir hatten immer plattdeutsch miteinander gesprochen – in der Sprache, mit der wir in unseren Elternhäusern groß geworden waren. Alles andere war gar nicht denkbar. Sogar in der Straßenbahn in Braunschweig zwischen Berliner Straße und Katharinenkirche hatten wir uns in heimischem Platt unterhalten. Damals, Mitte der 70er Jahre, gab es – ohne daß wir es zunächst merkten – unter den Fahrgästen eine Reihe verblüffter Gesichter.
Auch wenn nur wenig Zeit ist, das Gespräch hat mich berührt, auch ob seiner Unkompliziertheit und der sich rasch wieder einstellenden Vertrautheit. Nicht nur die gemeinsame Erinnerung, auch die Sprache, ist Schlüssel zu vergessen geglaubten Bildern, aber auch zum offenen Austausch über Sorgen und Probleme.
Diese Sprache ist nun einmal ein Kernbestandteil unserer Identität, der gemeinsamen Kultur! Allemal also verlangt ein Blick in ihre Zukunft zunächst einmal schlichte Ehrlichkeit. Das bedeutet: Wohl kaum wird man auch meine Zweifel ausräumen können, daß das Niederdeutsche als „gesprochene” Sprache in unserem Alltag die nächsten Jahrzehnte überstehen wird! Aber deshalb nichts machen? In der zuweilen allzu partikularen kulturellen Landschaft des Emslandes wird immer noch zu wenig für das Niederdeutsche getan. Gelegentliche Blicke nach Ostfriesland machen bei aller Kenntnis der unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen zuweilen geradezu beschämend die Unterschiede deutlich. Dabei geht es den Emsländern doch nicht anders als ihren Nachbarn. Das Verschwinden des Plattdeutschen würde uns ein Stück heimatloser machen.