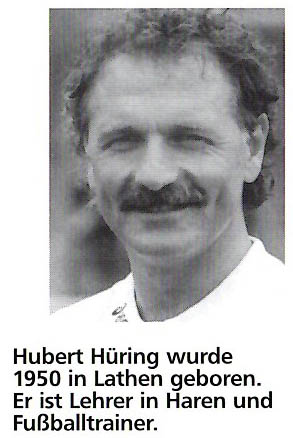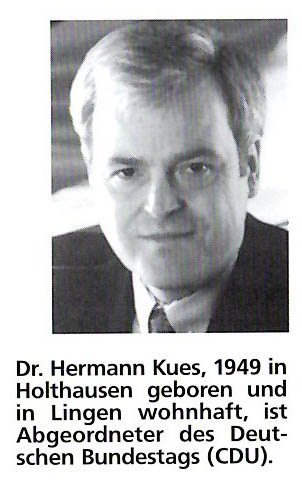Platt ist wie Fahrradfahren
Von Kindesbeinen an habe ich das Plattdeutschsprechen gelernt. Heute, nachdem ich in den letzten gut dreißig Jahren nur noch gelegentlich auf Besuch ins Emsland komme, spreche ich mit meiner Mutter oder mit verbliebenen Kumpels und Freunden aus der Volksschulzeit wie ganz selbstverständlich immer noch platt. Plattdeutsch ist wie Fahrradfahren: wenn man es einmal kann, verlernt man es nicht mehr.
Ich habe einen Freund in Osnabrück, der ist Landmaschinenvertreter. Und er hat für diesen Beruf durchaus das passende physische und mentale Format. Aber er ist ein Stadtkind. „Wenn ich dich um etwas wirklich beneide”, pflegt er.zu mir zu sagen, „dann ist es dein Platt.” Wenn man platt spricht, gehört man in gewissen, meist ländlichen Kreisen dazu. Das war immer so – auch, als es in anderen gewissen Kreisen als unfein galt, platt zu sprechen. Für meinen Freund, den Landmaschinenvertreter, wäre es durchaus absatzfördernd, wenn er richtig platt könnte und nicht nur fast richtig. Richtig platt kann man aber nur, wenn man es von Kindesbeinen an gelernt hat.
Das emsländische Platt, wiewohl von Dorf zu Dorf verschieden, ist leider schon eine dekadente Form des Plattdeutschen; im normalen Gebrauch ist es von vielen hochdeutschen und halbhochdeutschen Wörtern durchsetzt. Das ist in anderen Gegenden, in Ostfriesland etwa oder auch im Oldenburger Münsterland, anders. Da ist Platt noch eine richtige, eigene Sprache. Ich habe fünf Jahre in Oldenburg gelebt, und ich erinnere mich gern daran, daß ich damals noch den Entertainer Heinrich Diers kennengelernt habe, der es wie kaum jemand verstand, sein Publikum auf original Oldenburger Platt zu unterhalten.
Das emsländische Platt ist vielleicht keine eigene Sprache mehr, aber es hat seine Eigenart. Für mich persönlich bereichert es die Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks und der Verständigung auf eine sehr amüsante und liebenswerte Art und Weise. Viele plattdeutsche Wörter und Ausdrücke haben keine hochdeutsche Entsprechung. Wenn ich von einem gering zu schätzenden Sonderling sprechen will, dann nenne ich ihn auf Platt einen „Paijatz”; geht es gar um einen üblen Lumpen und Beutelschneider, dann spreche ich von einem „Schmeerlapp”. Und wieviel schöner ist es doch, einem Kind zu sagen: „Dat hestu aber mooi makt!” („mooi” je nach gewünschter Intensität auch mit drei oder noch mehr o zu schreiben und vor allem zu sprechen), als wenn ich es mit den Worten lobe: „Das hast du aber schön gemacht.” Auch das Wort „strumpeldune” sagt viel aus über emsländische Eigenheiten, während das ebenso gebräuchliche „scheißendicke” schon wieder ein Zwitter ist.
Schweinigeln läßt es sich auf Plattdeutsch natürlich auch viel besser und vor allem viel gesellschaftsfähiger als auf Hochdeutsch. Ein in richtig schönem Platt erzählter Witz darf ruhig ein bißchen schmutzig sein (manche meinen, er muß sogar schmutzig sein!), der Dialekt neutralisiert das Unanständige. Und erst das plattdeutsche Fluchen! Man möge in Bückers „Der Herzog und sein Kumpan” nachlesen, dort ist viel darüber zu erfahren.
Aber ich will nicht verschweigen, daß Plattdeutsch für mich auch negative Konnotationen und Konsonanzen hat. Das platte Emsland meiner Kindheit und Jugend ist leider nicht nur idyllisch, sondern auch bigott und intolerant, ja streckenweise chauvinistisch und reaktionär. Anders sein zu wollen, anders auszusehen und sich anders zu verhalten als der Durchschnitt, bedeutete in der plattdeutschen Gesellschaft nicht selten, nahezu aussätzig zu sein. Mich hat vor allem die latente, manchmal auch manifeste Sympathie für Deutschlands braune Vergangenheit, die mir als Kind ganz normal vorkam, weil ich sie fast täglich erlebte, später sehr gestört – auch Antisemitisches und Chauvinistisches, das auf dem platten Lande selbstverständlicher, alltäglicher war als in anderen Gegenden Deutschlands, die ich inzwischen kennengelernt habe.
Sicher, das hat mit der plattdeutschen Sprache direkt nichts zu tun, aber ich assoziiere es sehr leicht, wenn ich das emsländische Platt höre. Auch kann ich die kritiklose Preisung von Emsland-Büchern wie dem eben genannten „Der Herzog und sein Kumpan” nicht nachvollziehen, die ich etwa auf dem Georgianum in Lingen von Lehrern häufig gehört habe; der darin verpackte Chauvinismus und Antisemitismus sind (oder hoffentlich: waren) eben auch ein Kennzeichen des platten Emslands: Die schwindelnd hohe Auflage, die das Buch inzwischen erreicht hat, spricht Bände.
Trotz allem spreche ich gern platt. Einmal, auf einem akademischen Seminar, wo ‘sich allerhand gelehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Referentinnen und Referenten tummelten, traf ich einen, der mindestens genausogut platt konnte wie ich. Die anderen konnten es alle nicht. Wir beide haben uns dann abends beim gemütlichen Teil des Seminars, apres etudes` sozusagen, so richtig schön mitten in die kleine Kneipe gesetzt und uns nichtendenwollend auf Platt unterhalten, aber so, daß alle es hören mußten. Wir haben angegeben wie die Sülzsäcke. Es war zu einer Zeit, als es gerade wieder einmal schick war, Dialekt zu sprechen. Mein Gott, hat man uns respektvoll zur Kenntnis genommen! Wer eine solch schöne Sprache könne, sei doch beneidenswert, meinte man. Wir fühlten uns kulturell und überhaupt bedeutend.
Möge also das Platt nicht aussterben und möge es an Menschen nicht mangeln, die sich der Mühe unterziehen, auf Platt zu schreiben. Denn das kann ich nicht, jedenfalls nicht richtig. Ich habe zur Vorbereitung dieses kleinen Textes nochmal Fritz Reuter konsultiert, den Goethe der Mundartdichtung, das ist nun leider wieder Mecklenburger Platt, ganz was anderes als Emsländer Platt. Aber meine Reuter-Ausgabe hat ein schönes kleines Wörterbuch als Supplement, in dem man nachschlagen kann. Ich weiß nicht, ob es so etwas auch schon für das Emsländer Platt gibt; wenn nicht, dann sollten die Edlen es sich ihren Schweiß wert sein lassen, etwas entsprechendes anzufertigen. Dann kämen vielleicht auch manche inzwischen weitgehend vergessene Wörter wieder ans Licht und zu Ehren, wie zum Beispiel „föddelk” oder „klössen”, „puchen” oder „ampatt”. – In diesem Sinne: Munterholn!
Sch`manks
sch`morgens
sch`mirrages
sch`nommirrages
sch`noms
sch`nachens
sch maitiets