https://www.niederdeutschsekretariat.de/ueber-den-bundesraat-foer-nedderdueuetsch/

von Sohn Heinrich Hensen
Geert Hensen wurde am 14. April 1873 in Osterwald geboren und hat sein ganzes Leben dort auch zugebracht, wenn man von den Jahren 1916 bis 1918 absieht, in denen er als Trainsoldat nach Köln und Lodz (Polen) kam.
Er war das sechste und jüngste Kind der Eheleute Jan Hensen und Janna, geborene Dobben, aus Hohenkörben. Von ihr hatte er wohl „die Lust zum Fabulieren” geerbt, denn von den Schwestern unserer Großmutter wissen wir, daß sie Briefe in Versform schrieb, wie es Vater ja Zeit seines Lebens gern tat. Merkwürdigerweise ist er der einzige in der Geschwisterreihe, der sich in dieser Weise betätigt hat. Leider starb seine Mutter schon im Alter von 48 Jahren, als er erst sechs Lenze zählte. Zu seiner zweiten Mutter, die ein Jahr später ins Haus kam, hat er wohl nie eine rechte Beziehung gefunden. Er und seine Geschwister hatten sie immer Mütterchen genannt. – Wahrscheinlich ist er deshalb früh vereinsamt, denn er hat nie davon gesprochen, daß seine um drei bzw. sechs Jahre älteren Schwestern sich sehr um ihn gekümmert haben. Sein jüngster, um neun Jahre älterer Bruder Friedrich scheint ihm näher gestanden zu haben. Er wanderte mit 17 Jahren nach Amerika aus, wohl um dem drohenden Militärdienst zu entgehen. Er verunglückte dort bald in den Pullman-Waggon-Werken in Rozeland beim Rangieren. Seine silberne Taschenuhr erbte Vater und ist heute in meinem Besitz (Gravur: F. H.). – Diese beiden Todesfälle haben ihn wohl sehr beeindruckt. Als er 16 war, starb auch sein Vater im Alter von 62 Jahren. Die Volksschule besuchte er zunächst in seinem Heimatort, später wechselte er die Schule bzw. Lehrer, indem er eine Zeitlang in Esche zur Schule ging. Seine Erlebnisse dort sind in meinem Buch „ Knetsoahm vertäild“ (Seite 53 ) festgehalten.
Etwa mit 16 wurde er Kleinknecht in Osterwald, später in Alte Piccardie (1892/93), dann wieder in Osterwald beim Kolon Plescher, wo er unsere Mutter kennen lernte. In seinem Schwiegervater Hindriik Plescher (1841 – 1928) fand er einen Mann, der ebenfalls gerne Verse machte. Von ihm gibt es (im Familienbesitz) ein langes Gedicht in holländlischer Sprache über den Krieg 1870/71. Es wurde damals bei Kip in Neuenhaus gedruckt und im „Grafschafter”, Januar 1971 von Dr. H. Heddendorp besprochen.
Im Jahre 1893 begann er, seine „Gedichte” in ein fest gebundenes Heft einzutragen. Ich nehme an, daß er sie zu einem früheren Zeitpunkt verfaßt hat, denn fast alle sind tief religiös und todesdüster. Er beschreibt darin die Hölle, einen Leichenzug (Bruder Friedrich?), den Himmel, das Ende eines Trinkers, den Weg des Gottlosen und dergleichen. Diese Verse – in Deutsch oder Holländisch verfaßt – stehen im krassen Gegensatz zu seinen plattdeutschen Gedichten, die durchweg heiter sind. Mit 27 Jahren, als er einen eigenen Hausstand gegründet hatte, begann er seine Lebensgeschichte aufzuschreiben, die allerdings nur die frühen Kinderjahre enthält. Im Jahre 1952 hat er sie dann fortgesetzt. Dieses Heft, das auch viele Angaben zur Familienchronik enthält, wird im elterlichen Hause aufbewahrt.
Im Jahre 1900 heiratete er unsere Mutter, Jenne, geb. Plescher, und nahm Wohnung in Osterwald, Haus Nr. 20. Haus und Hof hatte er mit finanzieller Hilfe seines Schwiegervaters und Bruders für 10875 Mark erworben. Anfängliche Schwierigkeiten meisterte er mit seiner tüchtigen Frau, die ihm acht Kinder schenkte.
Vater war ein ungewöhnlicher Mensch. Er setzte sich abends unter den Lindenbaum und sang mit seinen Kindern Lieder, die er auf der Ziehharmonika begleitete. Er kannte viele Vogelstimmen und beobachtete die Natur. Auch erzählte er gern. Viele seiner Erinnerungen habe ich in meinem Buch „Knetsoahm vertäild“ festgehalten.
Einen Arzt kannte er nicht, er lebte natürlich und gesund. Im Winter wusch er sich gern den Oberkörper mit frischem Schnee, im Sommer ging er gerne morgens barfuß durch die taunassen Wiesen. Von den wenigen Büchern, die er besaß, scheinen mir das „Doktorbuch“, Pfarrer Heumanns Kalender, Bunyans Pilgerreise, Ch. H. Spurgeons „Reden hinter dem Pflug” und ein bescheidenes Fremdwörterbuch erwähnenswert.
Ein Fernrohr besaß er ebenfalls, aber einen Hang zur Jagd habe ich nicht festgestellt. Auf dem Hof machte er viele Dinge selbst in Ordnung, alles Gerät war stets an seinem Platz, gepflegt und geölt. Er warf nur etwas weg, wenn es nicht mehr zu gebrauchen war.
Die Versemacherei behielt er bis zum Lebensende bei. Sein erstes Gedicht, das veröffentlicht wurde (Oktober 1892): „Ach, das Kartoffelschälen“, trägt bescheidene sozialkritische Züge. In der Folgezeit konnte es ihm einfallen, über Ereignisse des Alltags plötzlich ,,Gedichte” zu machen. Sie sind zum Teil aber nur bruchstückhaft überliefert. Trotzdem habe ich den Versuch gemacht, seine uns erhaltenen Gedichte und Verse, von denen viele später im ,,Grafschafter” oder in den Jahrbüchern veröffentlicht wurden, zusammen zu stellen. Sie scheinen es mir wert zu sein, der Nachwelt – hauptsächlich den Kindern und Enkelkindern – erhalten zu bleiben.
Vater starb im Alter von 86 Jahren am 10. August 1959 und liegt auf dem Friedhof in Veldhausen begraben, an der Seite unserer Mutter, die ihm am 24. 5. 1972 im Alter von reichlichen 90 Jahren folgte.
Fotos: Familie Hensen
aus:
http://heimatfreunde-neuenhaus.de/Dichterplatt.html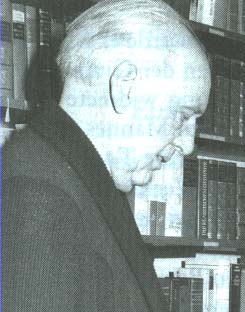
Unverwechselbar sind die Erzählungen, die Heinrich Hensen uns hinterlassen hat. Nach langer schwerer Krankheit ist der “urige Plattproater” am 5. Juli 1989 im Alter von 75 Jahren gestorben. Heinrich Hensen stammte von einem Bauernhof in Osterwald. Mit seiner Mundart-Prosa hat er sich in der Grafschaft Bentheim ein Denkmal gesetzt. Meisterhaft beherrschte der gelernte Pädagoge, bis zu seiner Pensionierung Rektor in Nordhorn, seine Muttersprache. Unzählige Geschichten hat er geschrieben oder erzählt, Geschichten zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Gleichsam ein Leben lang hat er sich damit in den Dienst seiner Heimat gestellt.
Nach wie vor fühlte sich der Verstorbene eng mit dem bäuerlichen Leben, Denken und Handeln verbunden. Aus der früher recht engen bäuerlichen Welt schöpfte er bis ins reife Alter hinein, gelang es ihm, die Menschen und die sie umgebende Atmosphäre treffend zu schildern. So entstanden seine Buchwerke “Aule Knetsoahm vertäild” und sein letzter Buchband “Geschichten up Groafschupper Platt”. Aber auch an der GN-Heimatbeilage “Der Grafschafter” und dem “Jahrbuch” des Heimatvereins hat Heinrich Hensen tatkräftig mitgewirkt. In den Reihen der Autoren dieser Schriften hinterläßt sein Tod eine schmerzliche Lücke.
Nach seinem Studium war der Pädagoge kurzfristig an der alten Nordhorner Mittelschule, dann in Kalle und in Schüttorf tätig. Acht Jahre war er Soldat und Kriegsgefangener. Nach seiner Entlassung baute er das Schulwesen in Vorwald aus dem Nichts heraus wieder auf. Dort hatte er 119 (!) Kinder in einer Klasse zu unterrichten. Einen nicht geringen Anteil hatten diese Kinder an dem Ausbau des Covordener Dieks, nachdem sie sich gemeinsam mit ihrem Lehrer bei dem früheren Verkehrsminister Dr. Seebohm in Bonn auf humorvolle Weise für dieses Projekt eingesetzt hatten. Bis 1965 war Hensen in Vorwald, dann wurde er Rektor der Evangelischen Blankeschule in Nordhorn. Im schulischen Leben der Grafschaft hinterließ er viele Spuren. Hauptsächlich nach seiner Pensionierung widmete er sich intensiv der Heimatarbeit. Die Erzähl- und die Vortragskunst dieses Mannes war einmalig. Hensen hat nicht nur fleißig geschrieben, sondern auch mehrere Tonbänder besprochen, um auch sehschwachen Menschen Zugang zu seinen Werken zu verschaffen.
Mit Heinrich Hensen ist ein Zeitzeuge heimgegangen, der kritisch und verständnisvoll zugleich seine Mitmenschen und seine Umwelt betrachtete. Er war ein ernster Mensch, der im privaten und familiären Bereich viele schwere Schicksalsschläge hinnehmen musste, darob dank seines unerschütterlichen christlichen Glaubens jedoch nie verzweifelte. Immer wieder überraschte er mit seinem tiefgründigen, feinen Humor.
Der Verstorbene hinterlässt der Grafschaft Bentheim ein reiches und kostbares Erbe.
Foto: Heimatfreunde Neuenhaus
Geboren am 30.7.1928 in Altheide Bad OT Neuheide
Vater Paul Wenzel, Fleischermeister u. Viehkaufmann geb. in Altheide (Polanica Zdroj)
Mutter Anna Wenzel geb. Wagner aus Neundorf (Nowa Wies) Kr. Habelschwerdt
beides alteingesessene Grafschaft Glatzer Familien.
8 Jahre Volksschule Altheide
1 ½ Jahr Städt. Handelsschule in Glatz
1944 „Unternehmen Bartold“
945 Volkssturm Glatz/Schäferberg
Mai 1945 Gefangenschaft tschechische Partisanen
eine Woche in deren Hand mit Siegesfeiern durch die Orte in der Tschechei dem Russen übergeben und im September 1945 entlassen
Januar 1946 Verhaftung durch die polnische Geheimpolizei (UB Urzad Beznieczenstwa Publicznego)
Vorhalt „Partisan“
eine Woche nächtliche Verhöre in deren Quartier in Altheide, der „Peter-Villa“ Abtransport nach Glatz in die „Zimmerstraße“ dort die bekannten schlimmen Erlebnisse Abtransport in das Gefängnis in der Gartenstraße ebenfalls mit bekannten Erlebnisse
im Mai 1946 als unschuldig entlassen, menschliches Wrack, an Leib und Seele gebrochen..
Vertreibung aus der Heimat November 1946 mit den Eltern über Quarantänelager Taucha b. Leipzig nach Meißen eingewiesen. Wegen Weigerung Eintritt FDJ keinen Arbeitsplatz. Einberufung zum Uran-Bergbau nach Aue. Vor Anreisetag im März 1947 Zuzugsgenehmigung in die britische Besatzungszone zu den im April 1946 in das Emsland vertriebenen Verwandten mütterlicherseits nach Plantlünne Krs. Lingen.
Familie: Heirat mit Marta Rickling, gebürtige Plantlünnerin (Emsländerin)
1959, 1961, 1965 Geburt der Kinder Michael, Klaus, Annegret
Beruf:
1947-1948 volles Jahr Städt. Handelsschule in Lingen wegen Abschluß „mittlere Reife“.
1948 – 1950 Banklehre
1950 – 1957 Kreditsachbearbeiter
1957 – 1970 Rendant der Raiffeisenbank Bramsche Kr. Lingen
1970 – 1992 Bankdirektor und Vorstandsmitglied der Volksbank Lingen
Mitglied in verschiedenen berufsständischen Organisationen wie Verbandsrat Genossenschaftsverband Weser- Ems
Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Industrie- und Handelskammer
1992 Verabschiedung in den Ruhestand
Politik: 1956 – 1958 Gemeinderat der Gemeinde Plantlünne Kr. Lingen (Wählergemeinschaft)
1961 – 1974 Gemeinderat der Gemeinde Bramsche-Wesel Kr. Lingen
1969 Eintritt in die CDU
1965 – 1974 Samtgemeinderat Bramsche
1972 – 1974 Bürgermeister der Gemeinde Bramsche-Wesel (1974 Eingemeindung in Stadt Lingen)
1974 – 1986 Rat der Stadt Lingen (Ems)
1974 – 1975 stellvertretender Bürgermeister
1975 – 1985 Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion
Kirche: 1957 – 1971 Rendant der Kirchenkasse St. Gertrudis Lingen-Bramsche
1966 – 1984 Mitglied Kirchenvorstand St. Gertrudis Lingen-Bramsche
1984 – 1996 geschäftsf. Vorsitzender Kirchenvorstand St.Gertrudis Lingen-Bramsche
Ehrungen:
1988 Goldene Ehrennadel des Deutschen Raiffeisenverbandes
1993 Bundesverdienstkreuz (u.a. wg. Verdiensten um deutsch-polnische Verständigung)
1993 Ehrenratsherr der Stadt Lingen
1994 Ehrenbürger der Stadt Polanica Zdroj (Altheide Bad)
1994 Päpstl. Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“ (auf Antrag des Breslauer Kardinals Gulbinowic in der Altheider Pfarrkirche überreicht vom heutigen Weihbischof Dr. Janiak)
1997 Ehrenmitglied des „Towarzystwo Milosnikow Polanica Zdroj“-Verein der Freunde und
Förderer der Stadt Polanica Zdroj – Altheide Bad
2001 Ring der Erzdiözese Breslau für Verdienste durch Kardinal Henryk Gulbinowic
2003 Ehrenteller der Heimatgruppe Grafschaft Glatz Lüdenscheid
2004 Ehrentitel „Botschafter der Grafschaft Glatz“ durch „Kapitel Hrabstwa Klodzko“ – Kapitel der Grafschaft Glatz
2006 Glockenpate der Glocke „St. Georg“ Pfarrkirche Polanica Zdroj-Altheide Bad
2006 Kreuz Hl. Stanislaus Anerkennung für Verdienste um Diözese Schweidnitz durch Bischof Ignaci Dec
2011 „Kleine Geschichte des Glatzer Landes“ von Prof. Arno Herzig und Dr. Malgorzata Ruchniewicz Widmung: Gewidmet Georg Wenzel, Reinhard Schindler, Janusz
Laska, Stanislaw Slowik wg. Einsatz für deutsch-polnische Verständigung.
2011 Aufnahme der Vita in die polnische Popularna Encyklopedia Ziemi Klodzkiej – Populär- wissenschaftliche Enzyklopädie des Glatzer Landes.
Verschiedene Ehrennadeln und Ehrenmitgliedschaften von und in Vereinen, Verbänden privater und beruflicher Art.
Aktionen: 1982 Gründer der „Polenhilfe Lingen“ mit jährlichen Hilfstransporten in die alte Heimat.
Bis heute Versorgung Waisenheim Altheide, Altenpflegeheim Oberschwedeldorf,
alte Menschen und kinderreiche Familien in Altheide,
Hilfe bei der Renovierung der Altheider Pfarrkirche und des Pfarrhauses und der Anschaffung neuer Glocken.
Hilfestellung bei der Erlangung von Mitteln aus der deutsch-polnischen Stiftung für den
Neubau des Krankenhauses in Altheide, für die Einrichtung des Kongreß- und Kultur-
Zentrums und Auflage einer Monografie in Polnisch..
1985 – 2005 Sprecher der Altheider Heimatgemeinschaft Atheide.
1991 Herausgeber des Buches „Heimatbuch Altheide Bad“
1996 – Herausgeber „Altheider Weihnachtsbrief“
1997 Mithilfe bei Ausstellung und Begleitband Ausstellung im Emslandmuseum
Lingen „Alte Heimat – Neue Heimat“.
2016 Anbringung eines Gedenksteines in Glatz/Klodzko in der Zimmerstrasse an die
dort von der polnischen Staatspolizei (UB) ermordeten Deutschen und Polen.
Hobby:
1943/44 Segelfliegen mit C-Prüfung
1947 – 1956 Fußball Blau-Weiß Lünne
Ab 1978 Familienforschung in der Grafschaft Glatz-Schlesien-Ostböhmen und Nordmähren sowie im Emsland- und Ortsgeschichtsforschung in Altheide Bad als Mitglied der Forschungsgruppe Grafschaft Glatz und des Arbeitskreises für Kultur und Geschichte.
… sprech ich wie der Mutter Mund
Heimat, Frieden, Liebe sind Wörter in unserer deutschen Sprache, die einen besonderen Klang haben. Heimat ist ein Stück Geborgenheit; und daran hat die Muttersprache einen wesentlichen Anteil.
Für mich war von Kindesbeinen an die plattdeutsche Sprache eben die Muttersprache. Wo diese Sprache gesprochen wird, da ist man zu Hause – auch dann, wenn man in der Fremde ist. Hört man dort einige Laute dieser heimischen Mundart, werden die Ohren gespitzt, die Menschen werden angesprochen, und mit strahlenden Augen werden Verbindungen geknüpft. Manche Bekanntschaft, manche Freundschaft ist dadurch entstanden. Es ist gleichsam so, als hätte man ein Stück Heimat in der unbekannten Umgebung getroffen.
Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, warum man von einer Muttersprache spricht? Ich denke, daß besonders in der Vergangenheit der junge Mensch die ersten Wörter und Sätze von der Mutter erhalten hat. Diese Wörter und Sätze bleiben oft im Leben des Menschen haften, bestimmen oft manche Entscheidung.
Ich stimme dem Dichter Max Schenkendorf zu, wenn er folgendermaßen formuliert:
Muttersprache, Mutterlaut
wie so wonnesam, so traut!
Erstes Wort, das mir erschallet,
süßes erstes Liebeswort,
erster Ton, den ich gelallet,
klingest ewig in mir fort!
Der Schluß des Gedichtes kommt zu der Feststellung:
Überall weht Gottes Hauch,
heilig ist wohl mancher Brauch,
aber soll ich beten, danken,
geb’ ich meiner Liebe kund,
meine seligsten Gedanken,
sprech’ ich wie der Mutter Mund.
In der Grafschaft Bentheim war in der Vergangenheit die plattdeutsche Sprache eben die Umgangssprache – in den Familien, in der Verwandtschaft, in Freundeskreisen, am Stammtisch, auf dem Markt oder wo auch immer. Dieses hat sich lange Zeit auf dem Lande und in der hiesigen Bevölkerung in den Städten weithin gehalten.
Es ist schade, sehr schade, daß die plattdeutsche Sprache langsam in den Hintergrund gedrängt wird. Berechtigte Hoffnung, daß das „Platte” nicht ausstirbt, weckt die Tatsache, daß die Landjugend in ihren Theateraufführungen wieder auf die alte Mundart zurückkommt. Mir fällt dabei auf, daß schon fast vergessene Ausdrücke und Bezeichnungen von Gegenständen wieder in Erinnerung gebracht werden. Gerade in humorvollen Passagen kommt dieses zum Ausdruck. Ich stelle fest: Die plattdeutsche Sprache ist gut einprägsam und ausdruckskräftig.
Nach meiner Meinung nimmt das „Plattdeutsche” in den kulturellen und sozialen Bereichen einen unverzichtbaren Platz ein, ja es ist selbst ein Kulturgut, welches wir nicht aufgeben dürfen. Ich lobe mir die schriftstellerischen Kreise, die sich die Erhaltung dieses Kulturgutes zur Aufgabe gemacht haben!
Genüsse für`s Publikum
Von Kindesbeinen an habe ich die plattdeutsche Sprache gelernt und gesprochen. Dies war für Jungen und Mädchen, die auf dem Lande groß geworden sind, die Regel. Aufgewachsen bin ich auf dem Hof meiner Eltern in Neerlage (heute Gemeinde Isterberg). Meine Eltern unterhielten sich mit mir und meinen weiteren sieben Geschwistern nur in dieser Mundart, wir wurden sozusagen in dieser Sprache erzogen. Nicht nur bei uns zu Hause, sondern ebenso in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, bei fast allen Bewohnern der Dorfgemeinde wurde so gesprochen. Nur in dieser Sprache verstand ich es, Dinge, Begebenheiten oder Ereignisse trefflich zu beschreiben. Hochdeutsch war für mich zum damaligen Zeitpunkt mehr oder weniger eine Fremdsprache.
Auf dem Hof Kethorn in Neerlage lebte und arbeitete während meiner Kindheit wie auf vielen anderen Höfen auch – ein Flüchtling. Er stammte aus Schlesien und unterhielt sich mit den anderen Haus- und Hofbewohnern in Hochdeutsch. Als Kind nahm ich einige „Brocken” davon auf und war stolz, da ich glaubte, im Vergleich mit Gleichaltrigen einen erheblichen Vorsprung in Sprachkenntnissen zu haben.
Dieser sogenannte Stolz wurde gleich am ersten Schultag gebrochen – ein Erlebnis mit bleibender Erinnerung: Unser Dorflehrer, Herr Meyer, malte mit Kreide eine Ameise an die Tafel und fragte uns „i-Männekes” nach diesem Tier. Mein Arm schnellte hoch und ich rief ohne zu warten „Michampel” in den Raum. Sogleich brach schallendes Gelächter der erfahrenen Mitschülerinnen und Mitschüler von Klasse zwei bis acht (in einem Klassenraum) los. In den nächsten 14 Tagen habe ich mich nicht mehr gemeldet.
Doch wer nun glaubt, daß er, wenn er plattdeutsch spricht, sich jeder Situation mit Gleichgesinnten ohne Probleme verständigen kann, der täuscht sich. Denn allein in der Grafschaft gibt es viele verschiedene Akzente und Begriffe. Ein Nieder-grafschafter versteht nicht unbedingt einen Obergrafschafter und umgekehrt. In einer Unterhaltung mit meinem landwirtschaftlichen Lehrling fragte er mich: „Wedderst du de Kalwer?” Nach nochmaliger Nachfrage mußte ich eingestehen, ihn nicht verstanden zu haben, und bat ihn, in Hochdeutsch zu fragen. „Fütterst du die Kälber?”, war die einfache Frage. Übersetzt in Obergrafschafter Platt: „Fuurst du de Kälwer?” Ich hat e es bis dahin nicht für möglich gehalten, die hochdeutsche Sprache für eine Verständigung von plattsprechenden Menschen heranzuziehen.
Eine solche Begebenheit zählt sicherlich zu den berühmten Ausnahmen. Vielmehr finden Menschen in und mit Plattdeutsch sehr schnell Kontakt – vor allem fern der Heimat. Anläßlich einer Exkursion in die Schweiz und nach Italien unterhielt ich mich angeregt mit meinen Kollegen, die aus allen Bundesländern angereist waren: in Hochdeutsch versteht sich. Plötzlich höre ich, daß jemand, der neben mir steht, plattdeutsch spricht – im Grafschafter Akzent. Ich frage ihn sogleich – selbstverständlich in Platt -, woher er kommt. Zu meiner Überraschung sagt er: aus Mecklenburg-Vorpommern. Eine vertrauliche Unterhaltung war von diesem Zeitpunkt an vorprogrammiert. Es blieb nicht nur bei einem allgemeinen Gedankenaustausch, es schloß sich eine intensive Fachsimpelei an.
In Gesprächen mit unseren niederländischen Nachbarn helfen plattdeutsche Kenntnisse, Sprachbarrieren zu überwinden, wenn man die niederländische Sprache zwar einigermaßen versteht, aber nicht gut sprechen kann. Ich war von meinen Parteifreunden der CDA eingeladen und sollte einen Vortrag über die grenzüberschreitende Verkehrspolitik halten. In den Niederlanden hochdeutsch sprechen wollte ich nicht. Daher wählte ich die artverwandte und für mich leicht zu sprechende plattdeutsche Version. Die Gastgeber hörten es gern und spendeten spontan Applaus.
Auch an einer anderen Stelle wird gern einmal applaudiert, wenn plattdeutsch gesprochen wird: im Niedersächsischen Landtag. Die Amtssprache in diesem Hohen Hause ist offiziell Hochdeutsch. So wird gesprochen in den Plenardebatten, in den Ausschußsitzungen, auf den Fluren, in den Ministerien. Wen wunderts. Doch in Sternstunden des Plenums verwöhnen wir Parlamentarier die Zuhörer, die Medienvertreter, die gesamte Öffentlichkeit mit „plattdeutschen Genüssen”, wenn es darum geht, die Niedersächsische Verfassung in Plattdeutsch herauszugeben, die Sendung ;Falk up Platt” im Samstagabendprogramm zu belassen oder Mittel für Schulen bereitzustellen, die die plattdeutsche Sprache in ihrem Unterricht bevorzugt pflegen. Ich bin dann immer wieder überrascht, wieviele Kolleginnen und Kollegen diese ungewöhnliche Debatte nicht nur verstehen, sondern sich auch vorzüglich einbringen können. Nur eine Personengruppe im Landtag hat dann eine besondere Schwierigkeit: die Stenografen.
Keine Schwierigkeit, Säle in der Grafschaft zu füllen, haben die Gruppen, die im Winter plattdeutsche Theaterstücke aufführen. Diese angenehme Erfahrung durfte auch ich in meiner Landjugendzeit machen. Alljährlich wurden unterhaltsame Dreiakter eingeübt. Allein die Übungszeit in den Abend- und Nachtstunden bereitete uns Laienspielern viel Freude, deftige Sprüche, anomale Verhaltensweisen oder Liebesszenen einzustudieren. Die Höhepunkte bildeten natürlich die Aufführungen in stets vollbesetzten Sälen. Eine Bestätigung unserer Schauspielkunst erfuhren wir plattdeutschen Laienspieler, als wir in die Abo-Reihe des Theaters der Obergrafschaft aufgenommen und neben den hochdeutsch sprechenden Berufsschauspielern erwähnt wurden. Es gab lediglich einen kleinen Unterschied: Bei unseren Vorstellungen war die Aula bis auf den letzten Platz besetzt.
Diese wenigen Beispiele verdeutlichen: Die plattdeutsche Sprache ist in meinem Leben ein fester Bestandteil – es wäre ein Stück ärmer, könnte ich sie nicht. Sie kommt mir darüber hinaus in der vielfältigen politischen Arbeit zugute, denn viele Menschen finden schneller Kontakt und fühlen sich sicherer und wohler, in dieser Form ihre Anliegen vortragen zu können. Vertraulichkeit, aber auch Originalität zeichnen diese Gespräche aus – der Gegenüber hat dann durchaus das Empfinden: Er versteht mich.
Meine Frau und ich haben uns seit unserem ersten Kennenlernen so unterhalten – und so wird es auch immer bleiben.
Daor küert se al up Holland to.
Gemeint ist mit diesem Satz das Platt der westmünsterländischen Grenzregion. Oder, wie es der damalige Landrat des Kreises Borken 1863 ausdrückte: „Wegen der benachbarten Niederlande ist in der Nähe der Grenze dieses Idiom ein Gemisch von plattdeutscher und holländischer Sprache.“ Wer sich für die Mundarten entlang der deutsch-niederländischen Grenze interessiert, wird daher u.a. mit folgenden Fragen konfrontiert: Was verbindet die Mundarten (die Dialekte, das Platt) von Twente, Achterhoek, Westmünsterland und Grafschaft Bentheim miteinander, wodurch unterscheiden sie sich und wie sieht es mit ihrer Zukunft aus? Es geht also um die früheren Zusammenhänge zwischen den Mundarten beiderseits der Staatsgrenze und die Entwicklung von Struktur und Gebrauch während der letzten Jahrzehnte.
Grenzdialekte gestern und heute: vom Dialektkontinuum zur Bruchstelle
Nehmen wir als Ausgangspunkt die sprachlichen Verhältnisse etwa um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: Die Dialekte beiderseits der Grenze waren Teil eines kontinental-westgermanischen Kontinuums, das sich von Dünkirchen im Westen bis Königsberg im Osten ausdehnte. Natürlich gab es kleinere oder größere Systemunterschiede zwischen den lokalen Dialekten und man konnte sie zu größeren Verbänden oder Sprachlandschaften gruppieren. Sie zeigten jedoch nirgendwo derart gravierende Systemunterschiede, dass man von einer echten Sprachgrenze, also einer sprachlichen Bruchstelle hätte reden können – auch nicht entlang der deutsch-niederländischen Staatsgrenze.
Dieses niederländisch-niederdeutsche Dialektkontinuum konnte bis ins 20. Jahrhundert relativ ungestört fortbestehen, denn zumindest bis zum Ersten Weltkrieg gab es eine recht lebhafte Kommunikation und damit sprachlichen Austausch über die Grenze hinweg.
(hier ungefähr das Foto Dialektforschung)
Die Standardsprachen Hochdeutsch und Niederländisch spielten bis zum Zweiten Weltkrieg im Alltagsleben der Bevölkerung keine bedeutende Rolle. Die Grenzdialekte waren zudem gekennzeichnet durch zahlreiche Entlehnungen sprachlicher Elemente von jenseits Grenze; dadurch hatten sie einen deutlichen Übergangscharakter. Das Achterhoeks, Twents und Drents, das Westmünsterländische, Bentheimische und Emsländische, sie bildeten gemeinsam eine Schwellenzone zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachgebiet (das gilt auch für die kleverländischen Mundarten am Niederrhein und im angrenzenden niederländischen Gelderland). Die Staatsgrenze trennte als systemische Sprachgrenze lediglich die Standardsprachen Niederländisch und Deutsch, nicht aber die eng verwandten mundartlichen Alltagssprachen. Die Vredener und Gronauer, die in Winterswijk oder Enschede zu tun hatten, konnten sich dort mühelos mit ihrem heimischen Platt verständigen.
(hier ungefähr die Karte Wortgeographische Kerngebiete)
Wenn man beispielsweise den plattdeutschen Wortschatz der Grenzlande nach seinen Herkunftsgebieten durchleuchtet, stellt man fest, dass er im Wesentlichen den Schnittmengen von drei Kerngebieten oder Großverbänden entspricht, und die liegen in Westfalen, in den Ostniederlanden und am Niederrhein. Die nebenstehende Karte zeigt diese Verbände in großräumiger Perspektive und macht zugleich den Übergangscharakter der Grenzlandmundarten sichtbar. Eine detailliertere Betrachtung würde zeigen, dass Wörter oder Lautformen sich in diesem Raum überlagern, die sich aus unterschiedlichen Richtungen einfach über die Staatsgrenze hinweggeschoben haben. So haben sich beispielsweise der Langvokal ää im Wort Lääpel ‘Löffel‘ gegenüber älterem Läppel oder das Wort Pugge ‘Schwein‘ vom Niederrhein her über Teile des Westmünsterlandes und des Achterhoeks ausgedehnt, das Wort Naomad ‘zweiter Grasschnitt’ dagegen von Westfalen her über Teile der östlichen Niederlande, während Wörter wie Kiewe ‘Backenzahn’, Röile ‘Schaukel’ und Kidde ‘Heureihe’ konzentrisch nur den Achterhoek und das Westmünsterland überdecken. All diese Dialektformen lassen erkennen, dass die Staatsgrenze für ihre Ausbreitung kein Hindernis war. Das kann man bei modernen Kulturwörtern, die heute meist unverändert aus den Standardsprachen übernommen werden, nicht mehr feststellen; den „neuen“ Mundartwörtern Kühlschrank, Mähdrescher/ Maidorsker und Düsenjäger beispielsweise stehen in den ostniederländischen Mundarten die Wörter koelkast, combine und straaljager gegenüber. Seit dem Zusammenfall von Staats- und Kulturgrenze, was ungefähr in den 1920er Jahren beginnt, geht der Übergangscharakter der Grenzmundarten
allmählich verloren, hauptsächlich wegen der zunehmenden Entlehnungen aus der jeweils eigenen Standardsprache. Als Folge eines veränderten Kommunikationsverhaltens der Bevölkerung dringen die Standardsprachen Hochdeutsch und Niederländisch in mehr und mehr Sprachdomänen vor, die früher dem Dialekt vorbehalten waren, beispielsweise beim Gespräch innerhalb der Familie zwischen Eltern und Kindern. Dadurch wächst auch der Einfluss der Standardsprachen auf die Dialekte. So bekommen Twents und Achterhoeks einen stärker „holländischen“ und die Dialekte von Bentheim und Westmünsterland einen stärker „deutschen“ Charakter, sie nähern sich zunehmend den jeweiligen „Hochsprachen“ an. Die Staatsgrenze entwickelte sich dadurch zu einer Bruchstelle im früheren Dialektkontinuum; am auffälligsten ist das im Wortschatz der Fall: Wenn die Bewohner der Twente heute von oetkering, ziekenhoes und bejaordentehoes sprechen, dann reden die Westmünsterländer auch auf Platt über Arbäitslosengeld oder Hartz IV, über Krankenhuus und Altersheim, um nur einige alltägliche Beispiele zu nennen.
Sprachwandel oder Strukturverlust
Wir müssen also konstatieren, dass sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts die Staatsgrenze in zunehmendem Maße zur Dialekt- und Sprachgrenze entwickelt hat. Sozio-dialektologische Untersuchungen haben zudem ergeben, dass gleichzeitig ein sehr starker Rückgang in der Beherrschung und im Gebrauch der Mundarten stattgefunden hat, vor allem bei der jüngsten Generation, wo er gegen Null geht. Beim Vergleich der Daten zeigen sich gleichartige Tendenzen beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze, aber mit folgendem Unterschied: Der Funktionsverlust, also der Rückgang im Gebrauch der Mundart als Alltagssprache, ist in den östlichen Niederlanden weniger stark als auf der deutschen Seite der Grenze. Beim Strukturverlust, d.h. bei der Annäherung der Mundart an die überdachende Standardsprache hingegen ist es genau umgekehrt: Die westniederdeutschen Mundarten sind da stabiler als die ostniederländischen, vermutlich, weil sie wenig gebraucht werden und sprachstrukturell viel weiter vom Hochdeutschen entfernt sind als die ostniederländischen Mundarten vom Standardniederländischen. Der häufigere Gebrauch der Mundarten in den Ostniederlanden ist wohl der Tatsache zuzuschreiben, dass sie sich sehr stark in Richtung der Standardsprache bewegen; man könnte dort inzwischen eher von (großräumigen) Regiolekten als von (kleinräumigen) Dialekten sprechen.
Eine derartige Entwicklung ist an der deutschen Seite der Grenze bisher undenkbar – hier verschwinden die Dialekte ganz einfach aus dem Alltagsleben. Auf der deutschen Seite der Grenze spricht man also (noch) Gronauer, Borkener oder Rekener Platt, westlich der Grenze hingegen eher Achterhoeks oder Twents, wo man früher die Ortsmundart von Winterswijk, Hengelo oder Ootmarsum hören konnte. Dialektbeherrschung und -gebrauch weisen aber nicht nur regionale, sondern auch individuelle Unterschiede auf – je nach Sozialschicht, Generation, Geschlecht oder Wohngegend, Sprechsituation und Herkunft der Sprecher. Eine detaillierte Erläuterung dieser Parameter würde hier zu weit führen, man kann die gegenwärtigen Verhältnisse aber etwa so zusammenfassen: Beherrschung und Gebrauch der Mundart liegen einerseits relativ hoch bei älteren Menschen, bei Männern, bei Einheimischen, bei Landwirten, in intimen Sprechsituationen (mit Ausnahme des Eltern-Kind-Gesprächs) und in ländlichen Gebieten, und andererseits relativ niedrig bei Schulkindern, bei Frauen, bei Zugewanderten, bei Managern oder Ärzten, in öffentlichen Sprechsituationen und in städtischen Wohngebieten.
Sprachwechsel oder Funktionsverlust
Wie konnte es zu der prekären Situation des Plattdeutschen als Alltagssprache der norddeutschen Bevölkerung kommen? Wie angedeutet, hat das Plattdeutsche während der letzten beiden Generationen einen enormen Rückgang an kompetenten Sprechern erlebt. In den 1930er Jahren verwendeten in Niedersachsen und Westfalen noch zwischen 50 % und 80 % der Eltern Plattdeutsch im Umgang mit ihren Kindern (abgesehen von einigen städtischen Regionen mit bereits damals niedrigeren Werten). Das Hochdeutsche blieb mehr oder weniger beschränkt auf einige formelle Situationen und auf den schriftlichen Gebrauch. Aber bereits vor dem Ersten Weltkrieg, und stärker dann in den 1920er und 1930er Jahren war unter dem Druck der Schulen eine Veränderung in Mundartbewertung und Mundartgebrauch in Gang gekommen. Diese veränderte Einstellung verlief seit dem Zweiten Weltkrieg rasend schnell und hatte den allgemeinen Sprachwechsel zum Hochdeutschen zur Folge. Wie das ablief, zeigt der mehrfach preisgekrönte Vredener Mundartautor Aloys Terbille (1936-2009) in seinem Gedicht Use Eegen.
(hier ungefähr im Kasten das Gedicht von Aloys Terbille: Use Eegen)
Um die Entwicklung zwischen den 1930er und den 2000er Jahren an einem Einzelbeispiel zu skizzieren, können wir auf die Entwicklung in der westmünsterländischen Gemeinde Heiden verweisen, für die – eher zufällig – entsprechende Daten zum Mundartgebrauch in der Konstellation „Eltern im Gespräch mit ihren Kindern“ vorliegen. Von 85 % im Jahre 1936 verläuft die Entwicklung über 51 % im Jahre 1964 auf 40 % 1971, dann auf 10 % 1981 und auf 2 % im Jahre 2001. Heute wird der Mundartgebrauch in dieser Konstellation vermutlich den Nullpunkt erreicht haben. Vergleichbare Zahlen werden auch aus anderen Grenzregionen genannt.
(hier ungefähr Abb. Mundartgebrauch i. d. Familie)
Außer den Eltern gibt es natürlich noch andere Bezugspersonen, von denen Kinder und Jugendliche die Mundart übernehmen könnten (z.B. die Großeltern, Nachbarn, Freunde, Kollegen usw.), und es gibt immer noch Regionen, wo die Mundart in etwas größerem Umfang an die Schulkinder weitergegeben wird, beispielsweise in der Grafschaft Bentheim und in Ostfriesland. Außerdem liegt die passive Beherrschung der Mundart (Hörverständnis) bei Kindern viel höher als die aktive; so hatten 1989 im Emsland 42,3 % der Zehnjährigen „gute“ sowie 37,4 % „nicht so gute“ Passivkenntnisse gegenüber 3 % „guten“ und 32,6 % „nicht so guten“ Aktivkenntnissen. In dieser ziemlich hohen passiven Dialektkompetenz könnte die Chance für Rettungsaktionen des Plattdeutschen liegen – wenn man denn wollte: Man müsste dann die Bevölkerung der bisher noch einigermaßen dialektbewahrenden Regionen (wie den Grenzgebieten Westmünsterland, Grafschaft Bentheim und Emsland) für die Einsicht gewinnen, dass man mit der Nicht-Weitergabe des Plattdeutschen freiwillig auf ein wichtiges Kulturerbe verzichtet und darüber hinaus der Kindergeneration die Vorteile der Zweisprachigkeit für die Entwicklung ihrer kognitiven Kompetenzen vorenthält. Aber könnte das gelingen?
Die Zukunft der Grenzmundarten: Kulturdialekt?
Das bisher skizzierte prekäre Bild der Grenzmundarten, vor allem auf deutscher Seite, steht in einem gewissen Gegensatz zu den Fortschritten, die das Niederdeutsche in Bereichen verbuchen konnte, die über die traditionellen Domänen Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis oder Arbeitsstelle hinausgehen. So gibt es heute an ungefähr zehn norddeutschen Universitäten Lehrstühle für niederdeutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, und in allen norddeutschen Bundesländern besteht die Möglichkeit, das Niederdeutsche innerhalb des Deutschunterrichts zu behandeln. Dazu gehört auch die Pflege der niederdeutschen Literatur in Autoren- und Literaturvereinigungen („Schriewerkringe“), Kongressen und Zeitschriften, aber auch ein niederdeutsches Theater- und Musikleben und eine regelmäßige Präsenz in den Print- und Funkmedien, neuerdings auch im Internet. Und dazu gehört die Anerkennung des Niederdeutschen als Regionalsprache durch den Europarat 1999 mit Maßnahmen, die zu seiner Förderung von staatlichen Instanzen getroffen werden sollen. Gleiches gilt übrigens für das Nedersaksisch im Osten und für das Limburgische im Süden der Niederlande.
(hier ungefähr 2 Fotos Drögen Bokelt / Up de Däle)
Anders jedoch als in den östlichen Niederlanden, wo die inzwischen zu Regiolekten mutierten Dialekte eine gewisse Überlebenschance haben, macht die Entwicklung der letzten Jahrzehnte im westlichen Westfalen vorläufig wenig Hoffnung auf die Bewahrung des Niederdeutschen – außer in Straßen- und Wirtshausnamen. Es ist kaum zu erwarten, dass das Plattdeutsche wieder die Rolle der Alltagssprache übernehmen könnte, denn es wurde in den letzten zwei Generationen ja in fast allen – selbst in den intimen – Sprachdomänen durch das Hochdeutsche ersetzt.
Dennoch stellt sich die Frage, ob denn überhaupt keine Aussicht besteht, das Niederdeutsche in einer – wenn auch funktional begrenzten – Rolle zu bewahren. In Ostfriesland scheint das übrigens gelungen zu sein. Hierzulande wird man sich vorerst wohl mit Sprachverhältnissen begnügen müssen, die man mit „kleine Zweisprachigkeit“ umschrieben hat: Plattdeutsch als Zweitsprache, als Kulturdialekt, als Hobby und Freizeitbeschäftigung, notfalls reduziert auf nur noch passive Kompetenz. Ein Anfang zur Verbesserung seines Ansehens könnte darin liegen, dass man Schüler im Deutschunterricht neugierig macht, indem man überhaupt noch darüber spricht. Vor allem müsste man aber die Einstellung eines großen Teils der Bevölkerung verändern, ein schwieriges Unterfangen.
Es geht dabei um die Definition der regionalen oder lokalen Identität, ausgehend von der Annahme: Je mehr sich jemand mit seiner Region oder seinem Wohnort identifiziert, je größer der Wunsch nach „Verwurzelung“ in einer bestimmten Landschaft, desto selbstverständlicher wäre dann die Einstellung, dass das Niederdeutsche auch heute noch zur Region gehört – nicht nur historisch, nicht nur in Frakturschrift und nicht nur bie’n Heimataobend!
Literatur
Ferdinand Freiherr von Hamelberg: Statistische Darstellung des Kreises Borken. Wesel 1863.
Ludger Kremer: Grenzmundarten und Mundartgrenzen. Untersuchungen zur wortgeographischen Funktion der Staatsgrenze im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet (Niederdeutsche Studien, 28). 2 Bde. Köln, Wien 1979.
Ludger Kremer: Das westmünsterländische Sandplatt (Westfälische Mundarten, 2). Münster 2018.
Ludger Kremer, Veerle Van Caeneghem: Dialektschwund im Westmünsterland. Zum Verlauf des niederdeutsch-hochdeutschen Sprachwechsels im 20. Jahrhundert (Westmünsterland. Quellen und Studien, 17). Vreden 2007.
Gertrud Reershemius: Bilingualismus oder Sprachverlust? Zur Lage und zur aktiven Verwendung des Niederdeutschen in Ostfriesland am Beispiel einer Dorfgemeinschaft. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 69 (2002) 163-181.
Bernd Robben: Der Schwund der plattdeutschen Sprache in der Region Emsland/Grafschaft Bentheim – Zwei Untersuchungen von 1990 und 2011. In: Emsländische Geschichte 19 (2011) 101-138.
Karl Schulte Kemminghausen: Mundart und Hochsprache in Norddeutschland. Neumünster 1939.
Tom F. H. Smits: Strukturwandel in Grenzdialekten. Die Konsolidierung der niederländisch-deutschen Staatsgrenze als Dialektgrenze (ZDL Beihefte, 146). Stuttgart 2011.
Dieter Stellmacher: Wer spricht Plattdeutsch? Zur Lage des Niederdeutschen heute. Eine kurzgefaßte Bestandsaufnahme. Leer 1987.
Aloys Terbille: Welldage. Niederdeutsche Gedichte aus dem Grenzland. Zelhelm, Vreden 1997.
Info
Prof. Dr. Ludger Kremer ist emeritierter Professor für Deutsche Sprachwissenschaft an der Universität
Antwerpen (Belgien). Seine Hauptarbeitsgebiete sind Dialektologie und Soziolinguistik sowie
Namenkunde der ostniederländisch-westfälischen Grenzregionen und deutsch-niederländischer
Sprachkontakt. Soeben erscheint von ihm im Aschendorff-Verlag das Buch Das westmünsterländische
Sandplatt (Westfälische Mundarten, 2). Münster 2018, 110 S., ISBN 978-3-402-14345-2.
von Rektor a.D. Franz Buitmann, Bersenbrück
„Zurück zu den Wurzeln“ – dieser Ausspruch ist in der gegenwärtigen Zeit ein gängiges Wort. Möchte man aber wirklich in eine Zeit zurück, die im Vergleich zu heute um ein Vielfaches schwieriger, härter, entbehrungsreicher und unsicherer war? Ich spreche von der Zeit in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges, von den Nachkriegsjahren und den Jahren des Wiederaufbaus Deutschlands in den fünfziger Jahren.
Diese Zeit habe ich, 1943 geboren, in einem Heuerhaus im Handruper Ortsteil Hestrup miterlebt. Mein Vater war wie so viele andere Männer Soldat der Wehrmacht geworden. Wie ich später von meiner Mutter erfuhr, in keinem Falle freiwillig. Viel lieber hätte er seine Arbeit als Stellmachermeister weiter geführt und wäre bei seiner Familie geblieben. So aber musste er in Russland an die Front gehen. Das letzte Lebenszeichen kam 1944 aus dem Raum Smolensk; seitdem galt er als „vermisst“. Bis heute habe ich keine Spur von ihm finden können, ich habe ihn also nicht bewusst kennen lernen dürfen.
Somit wuchs ich im Haus der Eltern meiner Mutter – eben in einem Heuerhaus – auf und wurde dadurch bedingt mit allen Arbeiten in der eigenen kleinen Landwirtschaft, aber auch auf dem großen Hof „unseres Bauern“, so sagten wir, vertraut. Da ich Einzelkind blieb, wurde ich von Anfang an wie selbstverständlich in den täglichen Lebensrhythmus einer Heuerlingsfamilie eingebunden.
Die anfallende Arbeit waren derart vielgestaltig, dass ich mehrere „Berufe“ gleichzeitig zu bewältigen hatte. Da galt es das Vieh zu versorgen, die Ländereien zu bestellen und später die Ernte einzufahren, Gartenarbeit zu verrichten, im Haushalt mitzuhelfen, Einkäufe zu tätigen, aufzuräumen, Ausbesserungen vorzunehmen, und vieles andere, angeleitet zunächst von meinen Großeltern und meiner Mutter. Aber zunehmend lernte ich selbstständig zu handeln und vor allem Verantwortung übernehmen – alles wichtige Erfahrungen für das spätere Leben. Was ich außerdem lernte, war mit Wenigem auszukommen. Die Heuer meiner Großeltern brachte gerade so viel ein, um „über die Runden zu kommen“.
Jeder Pfennig wurde zweimal umgedreht, bevor er ausgegeben wurde. Kleine Ersparnisse wurden trotzdem möglich, um für unvorhergesehene Ausgaben gewappnet zu sein. Es wurde kaum etwas „entsorgt“, so wie es heute üblich ist.
Speisereste wurden wieder verwertet, oder wenn nicht mehr genießbar, verfüttert. Der eigene Garten lieferte alles Notwendige, Fleisch stammte aus eigener Produktion.
Mit den nicht benötigten Hühnereiern wurden im Laden die Lebensmittel eingetauscht, die nicht selbst herzustellen waren. Nicht mehr brauchbare Haushaltsgegenstände wurden nicht weggeworfen, sondern auf den Boden gebracht, „man kann ja vielleicht noch mal Teile davon gebrauchen“. Dieses Aufbewahren galt auch für Geräte aus der Landwirtschaft. Bis heute fällt es mir schwer, mich von Gegenständen zu trennen, diese Art von Sparsamkeit hat sich bei mir tief eingegraben.
In meiner Erinnerung an das Leben in einem Heuerhaus ist mir besonders die Abhängigkeit, teilweise Hilflosigkeit, dem „Bauern“ gegenüber im Gedächtnis geblieben. Da hatte man für den nächsten Tag die Arbeit in der eigenen Landwirtschaft geplant, am späten Abend kam ein Kind des Bauern, um für den nächsten Tag einen Arbeitseinsatz auf dem Hof anzufordern. Da wurde nicht gefragt, ob man es einrichten könne, die eigene geplante Arbeit musste zurück gestellt werden. Als Entlohnung waren am Tag 50 Pfennige vereinbart worden, auch damals nicht gerade ein „Mindestlohn“. In einem eigenen Heft wurden die beim Bauern geleisteten Arbeitstage eingetragen. Die Gesamtzahl der Arbeitstage war mit dem Bauern vereinbart worden, konnte aber in besonderen Situationen geändert werden.
Unser Heuerhaus war teilweise mit Stroh gedeckt. Die Wände bestanden zum Teil aus Lehmgefachen. Nach und nach wurden die Lehmwände zwar durch Ziegelsteine ersetzt, aber ohne irgendeine Isolierung. Bei strengeren Wintern wachte ich morgens nicht selten auf, um an der Innenwand eine Eisschicht vorzufinden, die in der Nacht durch die Atmungsfeuchtigkeit entstanden war. Das Strohdach war an vielen Stellen undicht. Es wurde aus Kostengründen nur notdürftig mit eigener Hand ausgebessert. Ich entsinne mich, dass Ratten in das Stroh Löcher gefressen hatten. Nach einer längeren Trockenperiode schauten sie bei einsetzendem Regen aus den Löchern heraus, um zu trinken. Ich machte mir den Spaß, sie mit Erdklumpen oder Steinchen treffen und vertreiben zu wollen.
Die Toilette befand sich in einem Häuschen mit „Plumpsklo“ im Außenbereich des Hauses. Besonders im Winter und bei Nacht wurde es nicht gerade gern aufgesucht. Wasser schöpften wir zeitweilig aus einem Brunnen, später wurde es mit Hilfe einer Pumpe in der Waschküche gefördert. Nitratwerte waren ein Fremdwort.
Dabei wurde die anfallende Jauche von Mensch und Tier und ebenso das Material vom Misthaufen, auf dem alles Mögliche entsorgt wurde, in der Nähe des Brunnens in reichlicher Menge als Dünger ausgebracht. Das Abwasser floss – natürlich ungeklärt – in den nächsten Graben.
Auch wenn sicher der Heuermann in einer Abhängigkeit zum Bauern stand – letztendlich war es eine „Schicksalsgemeinschaft“, man war doch irgendwie aufeinander angewiesen. Ich muss sagen, unser Verhältnis zum Bauern war ein freundschaftliches. Wir fühlten uns nicht ausgenutzt. Feste wurden gemeinsam gefeiert, genauso wurde gemeinsam getrauert. Wenn meine Mutter im Winter dem Bauern beim Schlachten helfen musste, brachte sie abends immer ein Stück Fleisch als Dankeschön mit nach Hause. Das galt auch in Zeiten der Ernte bei Obst und Gemüse.
Ende der fünfziger Jahre näherte sich das Ende der Heuermannszeit. Zunehmend bekamen die Heuerleute die Möglichkeit, von ihrem Bauern das Haus mit einigen Hektar Land zu erwerben. So war es auch bei uns. An uns und zwei weitere Heuermannsfamilien verkaufte unser Bauer die Anwesen. Durch einen Neubau konnte die Wohnsituation bei uns wesentlich verbessert werden; die Zeit der Abhängigkeit war vorüber.
Ein bezeichnendes Erlebnis verdeutlicht die soziale Stellung eines Heuermanns in der Gesellschaft der damaligen Zeit. Am Ende der Grundschulzeit stand in der Volksschule bei Kindern, die das Zeug für eine weiterführende Schule hatten, die Frage eines Wechsels an.
Meine Mutter und meine Großeltern wären nie auf den Gedanken gekommen, mich auf ein Gymnasium zu schicken. „Wat segget wohl dei Naobers un Verwandten, een Hürmann-Junge kann dao nich hen!“ – das gehörte sich einfach nicht. Mein damaliger Klassenlehrer hatte alle Mühe, Mutter und Großeltern von einem derartigen Vorhaben zu überzeugen. Mit Tränen in den Augen aus Sorge um das drohende Gerede im Dorf stimmten sie schließlich zu.
Dass ich dann im Kloster Handrup mein Abitur machen konnte, in Vechta die Pädagogische Hochschule besuchte und 42 Jahre als Lehrer in Bersenbrück tätig sein konnte, davon 18 Jahre als Konrektor einer Orientierungsstufe und 15 Jahre als Rektor einer großen Grundschule – dieser Weg war mir sicher nicht im Handruper Heuerhaus in die Wiege gelegt worden. Mit Dankbarkeit und auch ein wenig Stolz blicke ich heute auf meinen Lebensweg zurück.