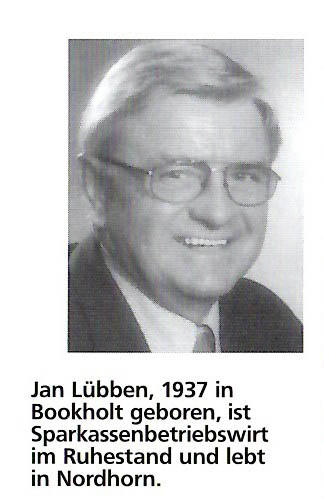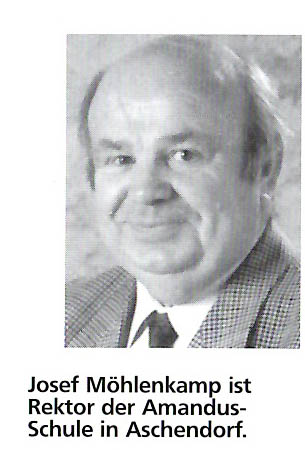Das bringen die Gesellen den Lehrlingen schon bei
Frage: Herr Löcken, Sie sind hauptberuflich als Bauunternehmer tätig. Daneben üben Sie die Funktion des Bürgermeisters in der Samtgemeinde Spelle aus. In welcher dieser beiden Tätigkeiten kommen Sie mehr mit der plattdeutschen Sprache in Berührung?
Antwort: Eigentlich spreche ich noch in beiden Bereichen oft die plattdeutsche Sprache, der größere Anteil liegt allerdings im Bauberuf.
Ich habe 1990 in einer Untersuchung zum Stand des Plattdeutschen im Landkreis Emsland bei etwa 3200 Schülern und deren Eltern festgestellt, daß die Landwirtschaft und das Baugewerbe die beiden Berufszweige sind, in denen das Plattdeutsche noch hauptsächlich gesprochen wird. Wie sieht es damit im südlichen Emsland aus? Gibt es einen Unterschied etwa zwischen älteren und jüngeren Handwerkern?
Auf den Baustellen wird nach wie vor zum größten Teil die plattdeutsche Sprache gesprochen. Bei den älteren Bauleuten ist dies eine Selbstverständlichkeit. Lehrlinge sprechen zunächst oft hochdeutsch. Allerdings ändert sich dies meist in den ersten Gesellenjahren, somit sprechen fast alle Gesellen auf den Baustellen plattdeutsch. Manchmal hört man auch die Frage älterer Gesellen an jüngere Kollegen: „Kannst du dich nicht vernünftig ausdrücken, kannst du kein Platt? Wenn nicht, dann lern’ es!”
Der Kundenkreis unserer Firma umfaßt die Samtgemeinde Speile, aber auch etwa zur Hälfte den westfälischen Raum: Rheine-Neuenkirchen-Hörstel-Ibbenbüren. Interessanterweise wird bei unseren älteren Kunden auch dort viel platt gesprochen. Hinzufügen möchte ich noch,tlaß die plattdeutsche Sprache bei Bauberatungs- und Auftragsverhandlungen in unserer Samtgemeinde bei Landwirten und älteren Menschen sehr behilflich ist. Damit wird oft schnell ein Vertrauensverhältnis erreicht.
Wie wird auf Innungsversammlungen gesprochen?
Auf den Innungsversammlungen wird im offiziellen Teil hochdeutsch, aber danach in Diskussionsrunden oder beim Glas Bier fast nur plattdeutsch gesprochen.
Wie stehen Sie selbst zum Platt ? Wo sprechen Sie es am häufigsten?
Ich spreche, wo es irgendwie geht, plattdeutsch; mit meiner Frau nur. Bei Familientreffen ist das interessant: Zwei Schwägerinnen sprechen nur hochdeutsch. Diese beiden Frauen werden auch von mir und meinen Geschwistern hochdeutsch angesprochen, alle anderen Gesprächsteilnehmer bleiben aber im gegenseitigen Gespräch beim Plattdeutschen. Mit unseren vier Kindern unterhalten wir uns allerdings nur in hochdeutscher Sprache. Alle vier verstehen zwar bestens Plattdeutsch, es zu sprechen fällt ihnen allerdings schwer.
Meine vier Kinder besuchten das Emsland-Gymnasium in Rheine. Hier stellten die Lehrer in der ersten Zeit im Fach Deutsch gewisse Schwierigkeiten fest – wohl beeinflußt durch das Speller Plattdeutsch. Dies war allerdings schnell behoben. Ich bedaure, daß an den Schulen die plattdeutsche Sprache nicht gelehrt wird.
Welche Zukunft geben Sie der plattdeutschen Sprache?
Wir alle sollten uns bemühen, die plattdeutsche Sprache zu erhalten. Ich meine immer, im Plattdeutschen kann man viele Dinge deutlicher und verständlicher ausdrücken. Ich glaube jedoch, daß es nicht allein genügt, diese Sprache nur von Alt auf Jung zu übertragen. Es ist zwar gut, daß Heimatvereine und einige andere Gruppen sich besonders dem Plattdeutschen widmen, aber die Forderung muß sein, diese alte Heimatsprache an den Schulen zu lehren und zu lernen.
Wie ist es in den Ratssitzungen? Gibt es noch Ortsteile im Raum Speile, in denen in den Ratssitzungen platt gesprochen wird?
In den Ratssitzungen selbst wird hochdeutsch gesprochen. Danach in weiteren Gesprächen teils hoch-, teils plattdeutsch. Als Bürgermeister der Samtgemeinde Speile ist die plattdeutsche Sprache für mich im Umgang mit unseren Freunden aus unserer Partnergemeinde Markelo/Holland ein besonderer Vorteil.
In den kleinen Ortsteilen hält sich bei der Bevölkerung die plattdeutsche Sprache besonders gut. So sprechen meine Stammtischfreunde — zwölf Männer zwischen 60 und 65 Jahren — nur plattdeutsch miteinander, und auch beim Kegeln, wenn die Frauen dabei sind, bleibt es beim Plattdeutschen. Auch bei den Jägern wird viel platt gesprochen. Zum Beispiel in der Jagdgemeinschaft Venhaus – elf Jäger zwischen 30 und 60 Jahren aus den verschiedensten Berufen – wird nur plattdeutsch gesprochen.